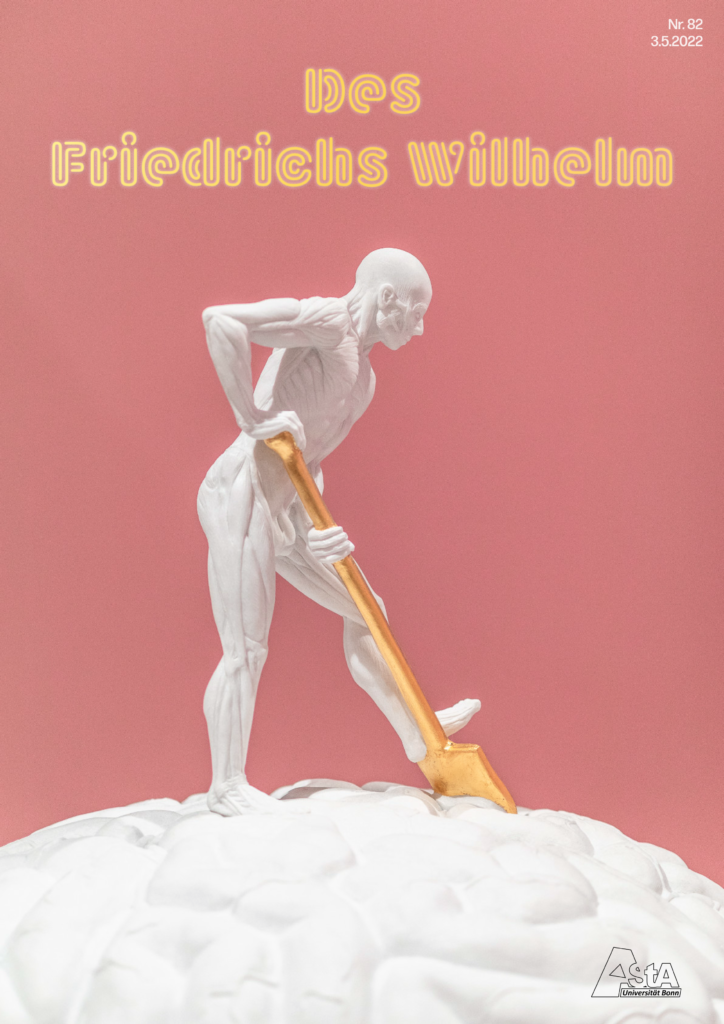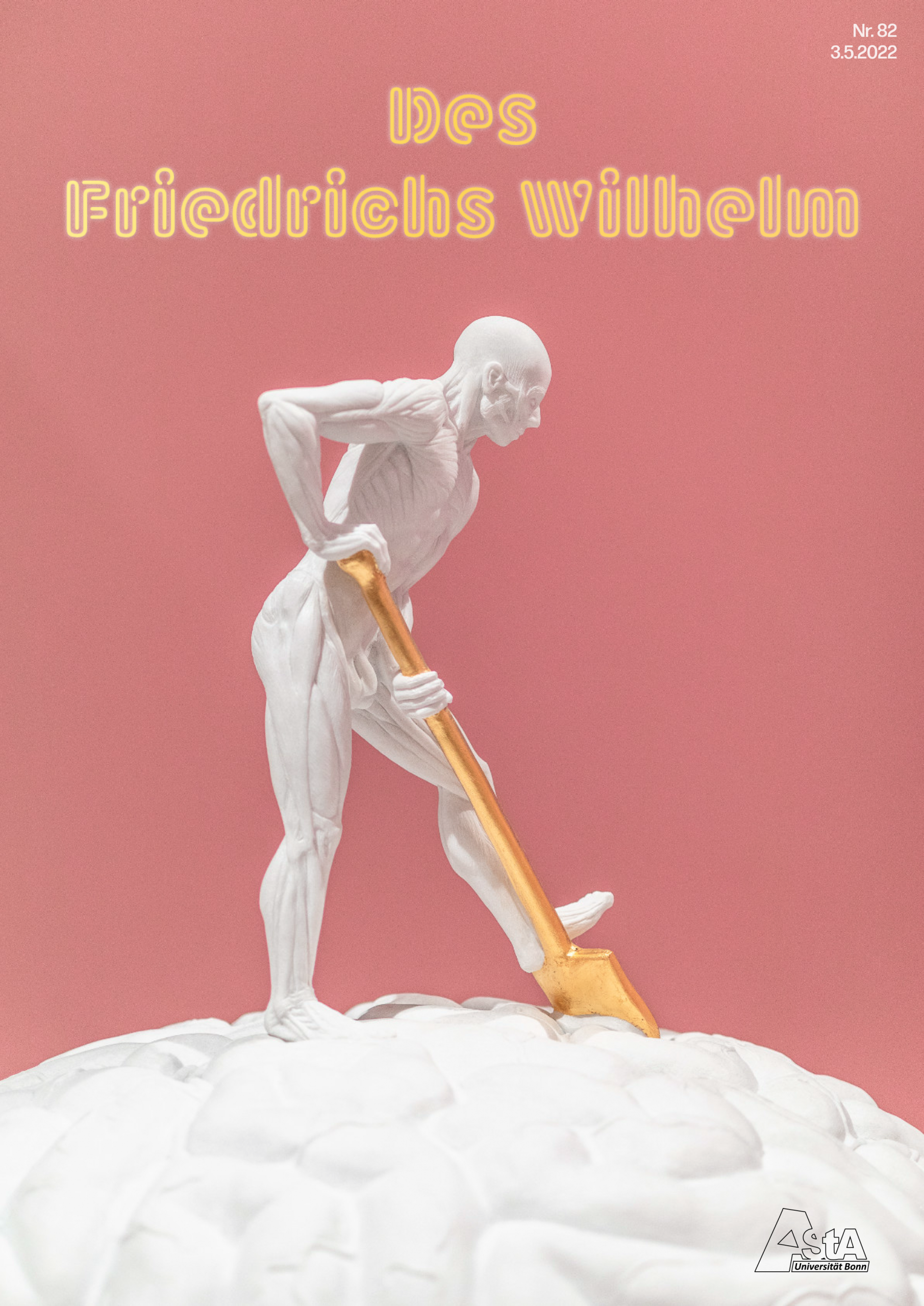
Editorial

Hallo liebe Leser:innenschaft,
unser aller Gesundheit wurde in den letzten zwei Jahren mehr gefordert denn je. Dabei hatten nicht nur unsere Körper mit einem unbekannten Virus und den neuesten Impfstoffen zu kämpfen, sondern auch unsere mentale Gesundheit wurde hart auf die Probe gestellt. Die gesellschaftlichen Probleme rund um dieses Thema blieben gleich und wurden höchstens potenziert. Mangelnde Therapie-Plätze, fehlende Unterstützung oder gar fehlende Anerkennung eines psychischen Problems, geschlechterspezifisch undifferenzierte Diagnosen und, und, und. Auch wenn diese Ausgabe rund um „Mental Health“ aufgestellt wurde, ist sie noch weit davon entfernt auch nur ansatzweise die vielen Nuancen des Themas aufzugreifen. Ich bin mir allerdings sicher, dass ihr trotzdem einiges mitnehmen werdet, ob Museums- oder Buchrezension oder Helenes Haltung zu Mental Health. Wir können nur hoffen, dass auf uns eine Zukunft wartet, in dem dieses Thema kein besonderes mehr ist, sondern von der Gesellschaft so normalisiert wurde, dass niemand von uns mehr damit zu kämpfen hat, die mentalen Herausforderungen des Lebens als solche anzuerkennen und Therapie selbstverständlich geworden ist. Eine Vorsorge braucht man schließlich nicht nur beim Zahnarzt.
Wir hoffen wie immer, dass euch diese Ausgabe gefällt und ich möchte mich hier ganz persönlich an dieser Stelle verabschieden. Das nächste Editorial wird von einer neuen Chefredaktion erstellt werden und meine Zeit in der FW geht leider dem Ende zu. Es war mir eine Freude, drei Jahre lang ein Teil dieser Zeitung zu sein und ich bin mehr als gespannt, wohin ihr weiterer Weg führen wird!
Viel Spaß beim Lesen!

Melina Duncklenberg, Chefredakteurin
Inhalts-verzeichnis
Gruselig – das Gehirn in der Bundeskunsthalle
Fear & Loathing in the Bundeskunsthalle
Ob ein Mensch als psychisch krank gilt oder nicht kann viele Ursachen haben
Eine Rezension zu Kurt Krömers Buch über Depressionen
ein Plädoyer für wellbeeing & die Überdenkung der Kategorien krank & gesund
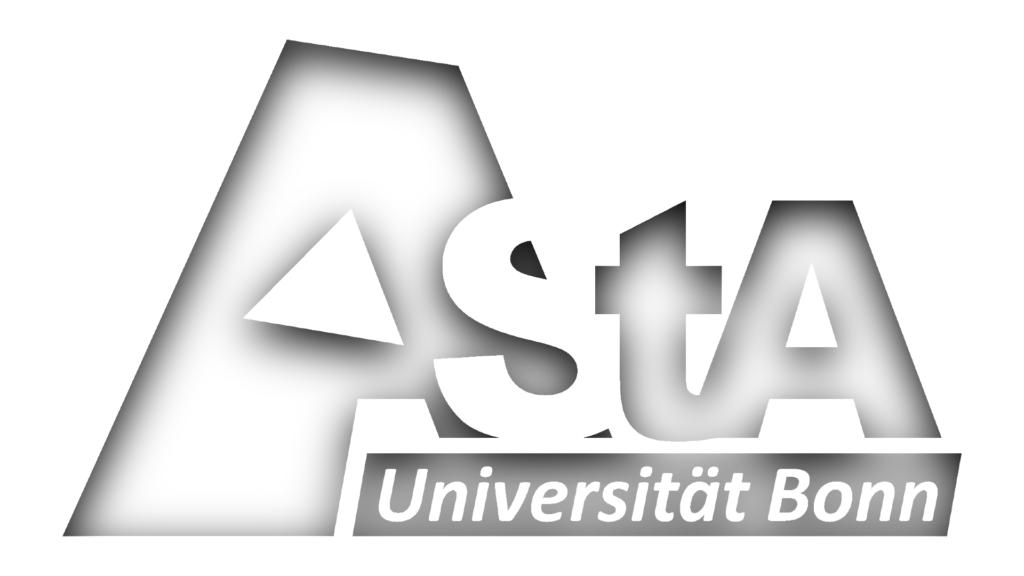

Kunst und Kultur
Das Genie des Gehirns
Die Ausstellung in der Bundeskunsthalle nähert sich dem geheimnisvollsten Ort unserer Gedanken
von Dorit Selting
03.05.2022 - Ausgabe 82
Spätestens seit den Black-Mirror-Dystopien sind wir fasziniert von der Idee, wie es wohl wäre, wenn wir uns von unseren Körpern lösen und in einem anderen Raum befinden könnten, ganz von unseren Gedanken gesteuert. Dass das aber nur Fiktion ist und sich Körper und Geist (genauer gesagt: Bewusstsein) nicht ganz so trennen lassen, war ja klar, schließlich ist die Serie ein Netflix-Produkt.
Die Schwierigkeit
Aber auch aus der ernsteren Perspektive der Mental-Health-Forschung bedeutet dieser Zusammenhang eine Komplikation. Denn bei den meisten Krankheiten passiert im Kopf nicht direkt die körperliche Reaktion. Außer bei Kopfschmerzen liegt das Leiden meist woanders. Es äußert sich nicht wie bei einem simpel gebrochenen Bein, sondern in viel unübersichtlicheren Verläufen, sodass das Krankheitsgefühl sich gar nicht so körperlich anfühlt. Und das, obwohl das Gehirn als zentrale Schaltstelle eindeutig ebenfalls ein Organ ist, das erkranken kann.
Wie das das Gehirn funktioniert, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau.
Aber ein kleiner Ausflug ins Regierungsviertel kann da vielleicht helfen.
Die Ausstellung
In der Bundeskunsthalle hat nämlich die Ausstellung “Das Gehirn. In Kunst & Wissenschaft” geöffnet.
Sie zielt nicht nur auf Wissensvermittlung ab, sondern ist auch eine ästhetische Annäherung an das Organ, wo Körperfunktionen sich mit dem Bewusstsein vereinen.
Wenn die Wissenschaften von Philosophie bis Psychologie nicht mehr weiter wissen kann die Betrachtung aus der Kunst helfen, das komplexe Thema des Gehirns zu verstehen.
Die Kunst arbeitet schließlich zusätzlich zu herkömmlichen Methoden mit Erscheinungen.
Erscheinungen meint, dass Objekte an abstrakte Ideen erinnern. Ein unaufgeräumter Schreibtisch ähnelt zum Beispiel unserer Auffassung vom Schubladen-Denken. Unser Verstand schließt dann vom Einen aufs Andere und wir sind aufmerksam für neue, vielleicht auch etwas zufällige Verknüpfungen und Visionen. Ist das Chaos vielleicht ein Symbol dafür, dass unsere Gedanken nie ruhen, auch nicht wenn wir schlafen?
Die Ausstellung ist in fünf Stufen aufgebaut, die sich konkreten Fragestellungen widmen (etwa “ Was habe ich im Kopf?” “Wie mache ich mir die Welt?”).
Zahlreiche Techniken verschiedenster Disziplinen sollen bei der Beantwortung helfen.
Neben Skulpturen, Illustrationen, Modellen, Malereien, Videos, Lichtinstallationen und optischen Täuschungen gibt es auch viele Erklärtexte, die aber anstatt Wissen zu vermitteln oft eher Fragen aufwerfen, zu denen es keine universellen Antworten gibt. Mein Favorit: “Ist man im Unbewussten noch verantwortlich?”
Im Großen schafft es die Bundeskunsthalle wieder, ein anstrengendes Thema zu veranschaulichen, sodass man nicht nur gestaunt, sondern auch gelernt hat.
Gang durchs Gehirn
Läuft man in die Ausstellung hinein, wird man direkt von einer Holzskulptur empfangen. Als Fresko an der Decke über ihr huschen Figuren wie in einem Film von einer Sequenz in die nächste, als würde sich in unserem Kopf tatsächlich ein Kino abspielen.
Dann kommt man im Vorbeigehen an einer weißen Steinnachbildung des Gehirns vorbei, auf dem eine Gestalt samt goldener Schaufel gräbt und meißelt, als wären unsere Gedanken selber Statuen, die im Steinbrocken schon schlummern und nur noch zur Sichtbarkeit geschliffen werden müssten.
Technisch funktioniert das so natürlich nicht. Aber vielleicht im metaphorischen Sinn? Erkennt man Antworten erst, wenn man alles andere, Unwesentliche wegschaufelt? Sind die Antworten vielleicht schon längst da, können wir sie nur noch nicht erkennen?
In Wissenschaft
Auf der Suche nach dieser Erkenntnis könnte man sich zunächst naturwissenschaftlich nähern. So findet man im ersten Abschnitt der Ausstellung zahlreiche Illustrationen und bunte Schemata, die dunkel an den Biologie-Unterricht erinnern, allerdings durch Bilderrahmen an den pinken Museumswänden sehr viel ansprechender aussehen.
Mit Plakaten nicht genug: auch Forschungsinstrumente der Neurologie werden ausgestellt, ebenfalls ältere Exemplare, die eher aussehen wie Folter-Accessoires.
Querschnitte des Gehirns sind auf Glas gerahmt, als wären sie bunte Kathedralenfenster und könnten so ein bisschen Erleuchtung bringen. Antike Zangen und Helme geben Aufschluss darüber, wie man sich das Innenleben im Kopf damals vorstellte. In der Renaissance-Kunst war es ein beliebtes Motiv, einen klaffenden Abgrund darzustellen, sobald sich die Schädeldecke öffnete.
Mir wird ein bisschen schwindelig, was bestimmt auch von den zahlreichen fleischigen Modellen kommt, die auf Glastischen liegen und in grau-blaue Zonen getupft mit karminroten Fäden durchzogen sind. Diese ganzen gelartigen Massen und Nerven sehen so außerirdisch aus, dass ich mich wirklich frage, wie so etwas auch in meinem Körper haust und mich beeinflusst.
»Der Körper ist gleichzeitig Grenze des Eindrucks und Gelegenheit des Ausdrucks.«
Und Kunst
Aber weg von Alien-Szenarien und hin zu Matrix-Simulationen.
Lässt man die anatomischen Strukturen nämlich hinter sich, kommt man zum nächsten Kapitel: der Wahrnehmung.
Um begreifbar zu machen, wie emotionale Abläufe funktionieren, hilft komplexe Wissenschaft oft nicht mehr weiter. Genau da knüpft dann die Kunst an, die Erkenntnisse auf eine ganz andere Weise vermitteln kann. Die Betrachtenden werden nämlich aufgefordert, durch künstlerische Konfrontation selber ihr Erleben von geistigen Prozessen zu reflektieren.
Gemälde, die aus subjektiver Perspektive die Entfremdung zeigen, werden wegen unmöglicher objektiver Selbstwahrnehmung buchstäblich selbst “verrückt” wie bei Max Ernst.
Der Körper ist gleichzeitig Grenze des Eindrucks und Gelegenheit des Ausdrucks.
Auf Bildern der Schizophrenie begegnen sich die Blicke mehrerer Augen, die innerhalb eines großen Gesichtes inception-mäßig gefangen sind.
Es geht in den Kunstwerken nicht darum, etwas anzuschauen, sondern eben in sich selber hineinzuschauen.
Und so fühlt es sich auch an, als würde ich mein Gehirn überlisten, wenn ich es instrumentalisiere, um mir über seine eigenen Zwecke klar zu werden. Kant wäre wohl nicht so begeistert.
Denkende Körper und bewegliches Bewusstsein
Er fände eine Herleitung aus dem Altgriechischen wahrscheinlich aufschlussreicher. Dort steht “Psyche” nämlich nicht nur für die Seele, sondern kann auch mit “Atem” übersetzt werden.
Wenn man sich das vor Augen führt, liegt es nahe, dass mit der Psyche auch körperliche Funktionen verbunden sind. Die Vorstellung, dass das Bewusstsein als abgetrennte Einheit vom Körper existiert, ist mittlerweile überholt. Unsere Wahrnehmung beeinflusst körperliche Reaktionen und umgekehrt.
Dieses ganzheitliche Verständnis kann eben da weiterhelfen, wo Krankheitssymptome keinen Aufschluss mehr auf Fehlvorgänge bieten. Denn Zusammenhänge können sich erst dann erschließen, wenn man mehrere Sichtweisen miteinander verbindet.
Zugegeben, als gesunder Mensch unvorstellbare Gefühlslagen und seelische Niedergeschlagenheit wie bei einer Depression nachvollziehen zu wollen, ist unmöglich, wenn man es selbst noch nicht erlebt hat.
Durch Kunstwerke, die sich dieser Krankheit widmen wird sie aber wenigstens zum Teil erfahrbar. Eine Malerei ist zum Beispiel auf Stoff gezeichnet, der an den Enden mit Fäden fest in den Rahmen gezurrt wird und dadurch ein Gefühl der Angespanntheit bis zum Zerreißen veranschaulicht.
Ganz werde ich das Gehirn wohl nie verstehen.
Aber die Ausstellung in der Bundeskunsthalle bietet auf jeden Fall genug Anreize, um sich mit dem für naturwissenschaftliche Nieten wie mich eher ungemütlichen (weil unbekannten) Terrain der neuronalen Vorgänge auseinanderzusetzen und auf künstlerische Weise die Aufmerksamkeit auf das Verhältnis von Körper und Bewusstsein zu lenken.
Zu diesem Thema hat Matt Haig im Kapitel “The Thinking Body” in seinem Buch “Notes On A Nervous Planet” über Depressionen geschrieben:
“We need to build a kind of immune system of the mind, where we can absorb but not get infected by the world around us”, denn er weiß:
“You can’t draw a line between a body and a mind any more than you can draw a line between oceans. They are entwined.”

Dorit Selting
lädt ein, neben Sci-Fi-Blockbustern auf Netflix auch mal in die Doku-Abteilung reinzuschauen. Dort gibt es die Serie „explained: Unser Kopf“ wo ihr in appetitlichen 20-Minuten-Happen alles Wissenwerte über das Gedächtnis, Psychedelika, Kreativität bis zur Gehirnwäsche verschlingen könnt.
Über die Autorin
Samuel Johanns
Zwar nicht der größte Hp-Hop Fan, aber der Song von Marteria wurde 2010 über Freunde an ihn heran getragen und löst nostalgische Gefühle aus.

Kunst und Kultur
Gehirne im Schrank
Eine Gonzoeske. Eine Ausstellung und journalistisch philosophische Versuche.
von Samuel F. Johanns
03.05.2022 - Ausgabe 82
Die Entscheidung war nicht ganz ohne Spontanität zur BuKuHa zu fahren, um das nötige Bildmaterial zur Ausstellungskritik der Kollegin zu liefern. Eigentlich verrückt, dass der Kollege sofort nach der Mensa direkt hinreichendes fotografisches Schießbesteck zur Verfügung hat.
An der Museumskasse bekommen wir spontan telefonisch eine Blitzakkreditierung und dürfen mit Kameras rein. Also gut, ich bin heute Modell journalistischer Recreation, das löst dann etwaige Probleme mit Persönlichkeitsrechten anderer Austellungsbesucher:innen.
Ich fühle mich schuldig und will trotzdem schreiben. Die Impulse aus dem Lehrbuch brodeln mir durchs Gehirn. Erweitern Sie Ihren journalistischen Schaffenshorizont, versuchen Sie ungewöhnliche Formate. Also gut, dann eben freies intuitives Journalling. Eine Gonzoeske muss her. Ist ja eh nur der Comic Relief zum anderen Artikel.
Die Ausstellung unterfordert ehrlich gesagt intellektuell ein wenig. Ich habe wenig mitgenommen, was ich nicht zuvor schon wusste. Philosophische Konzepte werden neben Büsten der Denker stark vereinfacht aufgegriffen und dargelegt. Sehr kompatibel für den Besuch von gymnasialer Mittelstufe. Eigentlich der Punkt, an dem man damals anfing, Papierflieger zu bauen und den Lehrkörper zu beschießen. Die Eintrittskarte hat ein längliches Format und ergibt ein äußerst schnittiges concordeartiges Überschall-Exemplar. Aber wo ist der Kurator? In einem Rollkragenkommando mittelalter Männer mache ich intuitiv den Rädelsführer aus. Ein infantiler Impuls will zielen. Das Über-Ich interveniert. Zum einen könnte es auch eine Kuratorin sein, du Sexist. Des Weiteren könnten auch Exponate verletzt werden bei deiner perfiden 9/11 Concordekatastrophe. Dies ist nicht der Ort! Ich gehorche.
Einige der Ausstellungsstücke über das menschliche Gehirn sind jedoch durchaus emotional inspirierend für das selbige eigene. Polyvalent edukativ, wie es die Berliner Didaktik beschreiben würde. Plastinierte Gehirne sehen wir aber tatsächlich keine, wie auf der Hinfahrt noch spekuliert. Aber einige echte Schädel, meist bemalt und aus verschiedenen Epochen. Mal phrenologisch, mal mit anderweitigen weltbildlich religiös motivierten Verzierungen. Die Infotafeln führen Knochen als gleichberechtigtes Baumaterial neben allem anderen auf. Die gewohnte White-Cube-Brutalität unserer Museen. Vor einem Cranium bleibe ich etwas länger stehen. Der originale Schädel des René Descartes. Von Jeremy Bentham war mir die Existenz eines Exponates seines konservierten Leichnams bekannt. Den Franzosen hätte ich jedoch gänzlich molekular verteilt vermutet. In einem praktizierend katholischen Elternhaus sozialisiert, machten Reliquien dennoch nie spirituell sonderlichen Eindruck auf mich. (TW: Polemik gegen Religionsgemeinschaft) Ich hatte nie den Impuls verspürt, Erbauung daraus zu ziehen, Pandemie förderlich am Steiß des heiligen Poperzius zu nuckeln. Zum katholischen Glaube halte ich alleine aus ethischen Gründen ein eher distanziertes Verhältnis aufrecht. Aber diese philosophische Reliquie macht Eindruck auf mich. Die Repräsentation des Cartesius in der Res Extensa. Die verfallene Ruine des berühmten Theater Gewölbes. Irgendwo da hinter der Schädeldecke hat einmal eine Zirbeldrüse gelebt und wurde von ihrem Besitzer als Heimat der immateriellen Seele gemutmaßt. Die Aura des Originalen fasziniert mich.
Bin ich etwa, wenn auch aufgeklärt säkular, doch kulturell hoffnungslos katholifiziert worden? Oder geht es anderen generell auch so? Ich beobachte meinen Kollegen, ebenfalls Student der Philosophie, aber unbescholten gottloser Ossi. Er schenkt den sterblichen Überresten des großen Dualisten nicht mehr oder weniger Beachtung als den anderen Exponaten… Na toll, meine ultramontanen Eltern haben ganze Arbeit an meinem Gehirn geleistet, das ist jetzt wohl nachhaltig so.
Fazit, eine durchaus psychoaktive Ausstellung, auch völlig ohne Angst und Schrecken auf Drogen.

Gesellschaft
Was als krank gilt
von Jan Bachmann
29.03.2022 - Ausgabe 81
Wer sich mit dem Umgang und der Behandlung psychischer Erkrankungen befasst, bekommt meist ein ernüchterndes, wenn nicht sogar deprimierendes Bild zu sehen: Das Angebot an Therapieplätzen kann den Bedarf bei weitem nicht abdecken, auch sind Fehlvorstellungen über psychische Erkrankungen leider in Teilen der Gesellschaft noch immer sehr verbreitet, was beispielsweise dazu führt, dass die Thematik für viele Menschen noch immer mit einer gewissen Scham behaftet ist. Auch gibt es viele psychische Erkrankungen, die nach dem aktuellen Stand der Forschung nicht, nur sehr schwer oder mit geringen Erfolgsaussichten geheilt werden können.
Festzustellen ist aber auch, dass die Situation aktuell besser ist als sie es jemals war. Die gesellschaftliche Akzeptanz für das Thema wächst, und auch in der psychiatrischen Wissenschaft und Praxis wurden große Fortschritte gemacht. Es ist kaum mehr als eine Generation her, dass psychische Erkrankungen (oder das, was man nach damaligem Stand der Wissenschaft dafür hielt) durch Lobotomien,
äußerst schmerzhafte Elektroschocks oder andere Barbareien „behandelt“ wurden.
Keine rein wissenschaftliche Frage
Durch den wissenschaftlichen Fortschritt, aber auch durch gesellschaftliche Entwicklungen hat sich der Umgang mit psychischen Erkrankungen geändert. Geändert hat sich im Laufe der Zeit aber auch, was überhaupt als psychische Erkrankung angesehen wird und was nicht. Homosexualität etwa wurde erst im Jahre 1990 von der Weltgesundheitsorganisation aus der Liste psychischer Krankheiten gestrichen. Was als krank gilt hängt allerdings nicht nur von rein wissenschaftlichen Faktoren ab. Viele psychische Erkrankungen werden von der Umwelt gar nicht oder nicht als problematisch wahrgenommen, solange die betroffenen Menschen in ihrer gesellschaftlichen oder ökonomischen Rolle noch „funktionieren“, obschon sie mitunter mit einem hohen Leidensdruck verbunden sein können. Die gesellschaftlichen Gegebenheiten wirken sich jedoch nicht nur auf die Diagnose, sondern auch auf den Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis selbst aus. Dass Frauen über lange Zeit die Fähigkeit zum rationalen Denken abgesprochen und allerlei Geistesschwächen wie Hysterie oder physiologischer Schwachsinn angedichtet wurde, war freilich nicht das Ergebnis empirischer Forschung, sondern das Resultat der damaligen Rollenbilder, sowie des Unwillens vieler Männer, an selbigen etwas zu ändern.
„Weibliche Hysterie“
Siegmund Freud, der als Begründer der Psychoanalyse gilt, gehörte zu den ersten, die psychisch bedingte Krankheiten auch bei Männern diagnostizierten. Ursache hierfür war wohl die öffentliche Befassung mit Soldaten, die durch ihre Erlebnisse im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 traumatisiert wurden. Generell wurde der Kampf der Frauenbewegung um Gleichberechtigung oft gezielt als eine Erscheinungsform der erwähnten weiblichen Hysterie abgetan. Frauen die Fähigkeit rational zu denken abzusprechen und ihr Denken und Handeln zumindest als von Gefühlen gelenkt, wenn nicht sogar als von einer Art hysterischem Wahn bestimmt, einzustufen, diente dabei nicht nur als Argument für die — damals noch wesentlich ausgeprägtere — Vormachtstellung des Mannes, sondern befreite die männliche Gesellschaft auch von der Notwendigkeit, sich mit den — ja völlig stichhaltigen und plausiblen — Argumenten der Frauenbewegung auseinander zu setzen: Die Pathologisierung von Frauen, die beispielsweise forderten, für die gleiche Arbeit auch den gleichen Lohn wie ihre männlichen Kollegen zu bekommen oder die ebenfalls das Recht haben wollten, an politischen Wahlen teilnehmen zu dürfen, als hysterische Irre abtut, braucht sich mit den eigentlichen Forderungen nicht zu befassen. Diese Denk- und Verhaltensweisen hielten und halten sich erschreckend lange. In den 50er Jahren wurde für Frauen, die — in Anbetracht der Situation, in der viele Frauen lebten, völlig zu recht — unglücklich und unzufrieden waren, eine spezielle „Medizin“ erdacht. Ein paar kräftige Schlucke „Frauengold“ halfen den Frauen dabei, wieder mit einem Lächeln auf den Lippen für ihren Gatten oder männlichen Vorgesetzten ans Werk zu gehen. Hauptwirkstoff des „Stärkungsmittels“ war übrigens Alkohol.
»Dass Frauen über lange Zeit die Fähigkeit zum rationalen Denken abgesprochen und allerlei Geistesschwächen wie Hysterie oder physiologischer Schwachsinn angedichtet wurden, war freilich nicht das Ergebnis empirischer Forschung sondern das Resultat der damaligen Rollenbilder sowie des Unwillens vieler Männer, an selbigen etwas zu ändern.«
Pathologisieren in der politischen Auseinandersetzung
Glücklicherweise hat sich die Gesellschaft hier weiterentwickelt. Das Pathologisieren von Menschen als Mittel der politischen Auseinandersetzung ist jedoch nicht verschwunden: Dort, wo man sich nicht mit einem Argument befassen will, ist es eine verbreitete Strategie, die:denjenigen zu pathologisieren, die:der es ausspricht. Ein besonders plumpes Beispiel hierfür ist, dass in bestimmten durchaus populistischen Kreisen, in denen man die Notwendigkeit von Maßnahmen zum Klimaschutz nicht erkannt hat und wohl auch nicht erkennen will, entsprechenden Forderungen und Argumenten von Fridays-for-Future Aktivist:innen entgegengehalten wird, Greta Thunberg habe ja das Asperger-Syndrom, weshalb man auf das, was sie sage, nichts geben könne.
Pathologisiert wird, als reichlich plumpes politisches Mittel, jedoch nicht nur wer unbequeme Standpunkte vertritt. Vielmehr lassen sich durch das Pathologisieren bestimmter Personen auch diverse Wahrheiten — zurückhaltend formuliert — umdeuten. Ist etwa ein Attentat politisch motiviert oder handelt es sich um die Tat eines „verrückten“ Einzeltäters, eines „einsamen Irren“? Ein bekanntes Beispiel ist der Anschlag auf das Oktoberfest im Jahre 1980, bei dem 13 Menschen getötet und über 200 verletzt wurden. 1982 lautete das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen, ein Einzeltäter habe die Tat „aus einer schweren persönlichen Krise und/oder aus übersteigertem Geltungsbedürfnis“ heraus begangen. Der rechtsextreme Hintergrund des Täters und eine Verstrickung in die rechtsradikale Szene wurden — wohl aus politischen Gründen — nicht beachtet. 2020 kam die Bundesanwaltschaft zum Ergebnis, dass es sich eindeutig um einen rechtsextremen Terrorakt gehandelt habe.
Ein weiteres Beispiel ist der Umgang mit der antisemitischen Schmierwelle: Nachdem Ende des Jahres 1959 ein Hakenkreuz und eine antisemitische Parole an die Kölner Synagoge gepinselt wurden, kam es binnen weniger Tage zu hunderten ähnlicher Taten in ganz Deutschland, was vor allem international für Besorgnis sorgte. Kanzler Adenauer beschwichtige im Interview mit dem US-amerikanischen Fernsehen: Bei den Tätern handele es sich um Verrückte, die noch hier und da rumliefen und von der Allgemeinheit eher ausgelacht würden.
Eine Auseinandersetzung mit dem strukturell in der deutschen Gesellschaft vorhandenen Antisemitismus wurde durch die Pathologisierung der Täter:innen verhindert.
Nicht erkannte Erkrankungen
Umgekehrt kommt es auch vor, dass vielen Menschen ihre psychischen Erkrankung ganz oder teilweise abgesprochen werden, obwohl sie darunter leiden. Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Eine wichtige Rolle in diesem Zusammenhang spielt aber sicher der eklatante Mangel an Diagnose- und Therapiemöglichkeiten. Hinzu kommen bei vielen Menschen leider noch immer grundsätzliche Vorbehalte psychische Erkrankungen ernstzunehmen. Ein Mensch, dem es beispielsweise infolge einer depressiven Erkrankung an Antriebskraft fehlt und den das Erledigen einer für die meisten Menschen alltäglichen Aufgabe vor eine schier unmöglich zu bewältigende Herausforderung stellt, der sei eben willensschwach. Wenn man sich „ein wenig zusammenreißt“, dann gehe das schon. Darüber hinaus ist für viele Menschen der gesamte Bereich psychischer Krankheiten — wie eingangs erwähnt — auch noch mit einer gewissen Scham verbunden. Man will nicht als „verrückt“ gelten. Insgesamt hat sich, und das ist zu begrüßen, der Umgang mit psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren deutlich verbessert. Eine wichtige Rolle hierbei spielen Menschen — seien es Prominente in den Medien oder Menschen aus dem sozialen Umfeld —, die offen über ihre Erkrankung sprechen.
Das Nichterkennen psychischer Erkrankungen ist nicht nur wegen der fehlenden Möglichkeit einer Behandlung problematisch. Oft verursacht auch schon die fehlende Diagnose zusätzliches Leid. Nicht selten wird als vermeintliche Ursache für Verhaltensweisen, die durch eine nicht erkannte psychische Erkrankung bedingt sind, eine Charakter- oder Willensschwäche herangezogen.
Beispiel: Gesichtsblindheit
Führen wir uns die möglichen Folgen einer fehlenden Diagnose einmal anhand eines Beispiels vor Augen: Menschen, die unter Prosopagnosie — auch Gesichtsblindheit genannt — leiden, verfügen nicht über die Fähigkeit Menschen anhand ihres Gesichtes zu erkennen. Verursacht werden kann diese Erkrankung, für die keine wirksame Therapie bekannt ist, durch Verletzungen im Gehirn, die etwa durch einen Schlaganfall oder Unfall entstehen können. Eine Studie aus dem Jahre 2005 stellte außerdem fest, dass etwa 2,5% der Menschen — also jeder 40. Mensch — an einer vererbten Form der Prosopagnosie leiden. Rein statistisch dürften also die meisten Menschen schon einmal mit einer betroffenen Person zu tun gehabt haben. Bei der überwiegenden Mehrheit der Betroffenen ist die Krankheit niemals diagnostiziert wurden, ein großer Teil wird sicher nicht einmal wissen, dass ein entsprechendes Krankheitsbild überhaupt existiert. Es braucht nicht viel Fantasie um sich vorzustellen, wie sich die Prosopagnosie auf das Sozialleben auswirkt. Wie Freundschaften schließen oder zumindest Bekanntschaften vertiefen, wenn durch häufiges Nichtgrüßen und Nichterkennen bei den Mitmenschen ein abweisender oder gar ablehnender Eindruck entsteht, dessen sich die Betroffenen, die nichts von ihrer Erkrankung wissen, oftmals gar nicht bewusst sind? In vielen Fällen würde schon das Wissen um die eigene Krankheit helfen, entstehende soziale Probleme zu entschärfen.
Suchtkrankheiten
Problematisch ist auch der Umgang mit vielen Suchtkrankheiten. Auch hier werden oft die Erkrankung selbst oder die Verhaltensweisen, die mit ihr einhergehen, falsch eingeschätzt und den Betroffenen eine Willensschwäche oder ein Mangel an Disziplin vorgeworfen. Einige Zeitgenossen:innen treiben es gar soweit, einer bettelnden Person Lebensmittel zu geben, aus Angst, eine Geldspende könne zum Kauf von Drogen verwendet werden. Ein solches Vorgehen ist nicht nur paternalistisch, sondern verkennt auch die Zwänge, unter denen ein suchtkranker Mensch steht: Wer etwa heroinabhängig ist, dem ist am ehesten —vorausgesetzt, es stehen keine adäquaten Therapiemöglichkeiten zur Verfügung, was leider meist der Fall ist — mit der nächsten Dosis Heroin geholfen.
Eine gewisse Veranlagung zu Suchtkrankheiten ist erblich. Äußere Faktoren spielen aber auch eine große Rolle. In Deutschland sind — je nach Anstalt — etwa 30 bis 50 % der Gefängnisinsass:innen drogenabhängig, was nicht zuletzt eine Folge der Haftbedingungen ist. Perspektivlosigkeit, Tristesse, die fehlende Möglichkeit einer Arbeit oder einer anderen Beschäftigung nachzugehen.
Die äußeren Umstände sind es auch, mit denen wir diesen kleinen Streifzug beenden wollen. Auch sie können Leid verursachen. In Anbetracht der Wirklichkeit, wie sie sich uns im Moment zeigt, deprimiert oder verzweifelt zu sein, ist sicher für viele leider etwas normales. Hoffnung gibt aber die Tatsache, dass der Mensch in der Lage ist, die Welt in der er lebt, zu gestalten und zu verändern, was im Übrigen wesentlich empfehlenswerter ist, als sich in einer unzureichenden Welt einzurichten — mit einer Flasche Frauengold oder irgendwelchen Achtsamkeits-Lehren.

Kurt Krömers „Du darfst nicht alles glauben, was du denkst“ und andere Berichte über Depressionen
eine Rezension von Ronny Bittner
03.05.2022 - Ausgabe 82
Dieser Text ist keine klassische Produkt-Rezension. Etwas in mir stellt sich quer beim Gedanken daran. Kann man ein Buch über persönliche Erlebnisse dieser Art tatsächlich bewerten? Wie viele Sterne ist eine Depression denn so wert? Mehr als ein Reizdarm? Handelt es sich bei dieser Art von Sachbüchern eigentlich noch um Erfahrungsberichte oder ist es schon Ratgeberliteratur? Zumindest auf diese Frage habe ich eine Antwort: Ein definitives Vielleicht.
Im März 2021 hat Krömer in seiner Show „Chez Krömer“ im Gespräch mit Torsten Sträter – selbst an Depressionen erkrankt und Schirmherr der Deutschen DepressionsLiga e.V. – seine Erkrankung öffentlich gemacht und berichtet, dass er seit rund 30 Jahren darunter leide, es ihm aber nun nach einer Therapie besser gehe. Was nach der Ausstrahlung über ihn hereinbrach, markiert den Beginn von Krömers Erzählung, die Reaktionen der Medien war überwältigend – und wohlwollend. Die in der Show berichteten Gefühle und Erlebnisse haben Menschen erreicht, die sich in ihnen wiederfanden und so Krömer zum Schreiben des Buches ermutigten, der seinerseits Mut machen will – denn es geht gut aus.
Kurt Krömer ist eine Kunstfigur des Komikers, Schauspielers und Autors Alexander Bojcan. Beim Thema Depression wurde keine Trennung zwischen Privatperson und Kunstfigur vorgenommen. Wenn Alexander Bojcan Depressionen hat, dann hat eben auch Kurt Krömer Depression. Verstecken ist nicht.
»Wenn Alexander Bojcan Depressionen hat, dann hat eben auch Kurt Krömer Depression. Verstecken ist nicht.«
Im Buch wird aus der Innensicht über Suchtverhalten, Familienprobleme, Aha-Momente, den Weg zur Therapie und einen Klinikaufenthalt erzählt, der neben Aufrichtigkeit vor allem durch eines überrascht: Würde. Es ist weder Selbstdemontage noch Selbstgeißelung im Rampenlicht. Schonungslos spricht Krömer über Situationen, in denen er anstrengend oder ungerecht war. Er berichtet dies auf eine rückblickend verstehende Art, sodass die Situationen jeweils nachfühlbar und gewissermaßen einzuordnen sind. Die teilweise Absurdität versteht Krömer dabei pointiert zu vermitteln, sodass auch der Humor im Buch nicht zu kurz kommt. Dadurch bleiben Wärme und Würde nicht nur von Krömer selbst, sondern auch den Personen seines Umfelds gewahrt, die er nur so wenig wie nötig in seine Erzählungen einbindet.
Kurt Krömer ist nicht die erste bekannte Person, die ein Buch ihre Erkrankung mit Depression schreibt. Er ist auch nicht die erste Person aus dem Comedy-Bereich. Warum ist sein Buch dann aktuell so erfolgreich? Bei Romanen und Berichten zu Depressionen gibt es mitunter die Erwartungshaltung, durch dieses Buch Hilfe zu erhalten, vielleicht sogar eine Art Weg zur Heilung – all dem gibt Krömer selbst zu Beginn seines Buches eine Abfuhr: Er möchte Mut machen. Das mag banal erscheinen, ist jedoch von großer Bedeutung. Die Situation rund um Therapieplätze und Unterstützung durch Krankenkassen ist eine Katastrophe. Menschen, die sich psychologische Hilfe suchen, können keine Laufbahn als Beamte:r einschlagen. Dabei hat sich gesellschaftlich auch vieles zum Guten gewandelt – vor 30 Jahren wäre ein solches Buch schwer vorstellbar, eine Fortsetzung der Karriere nahezu unmöglich gewesen. „Depressionen? Sowas hat es doch früher bei uns nicht gegeben!“
Vereinzelt ist noch zu lesen, dass Kurt Krömer mit einem Tabu brechen würde. Ich denke jedoch nicht, dass es sich tatsächlich um eines handelt – Depressionen sind eine Krankheit, die jede:n treffen kann und die sich behandeln lässt. Es gibt eine ganze Reihe lesenswerter Ratgeber und Erfahrungsberichte, in der Musik ist das Thema ebenfalls überall zu finden. Es hilft niemandem noch so zu tun, als wäre es eine unerhörte Nachricht – am wenigsten den betroffenen Personen selbst, für die es ebenfalls eine weitere Hürde sein kann. Niemand ist verpflichtet öffentlich darüber zu sprechen und sich als Erklärbär:in auf ein Thema festlegen zu lassen. Es ist jedoch gut und wichtig, wenn Menschen darüber sprechen, um Verständnis und Bewusstsein für die Symptome und mögliche Behandlungen zu schaffen. Vielleicht wird eines Tages niemand mehr sagen „Mensch, jetzt lach doch mal wieder!“
Wenn ihr an weiteren Erfahrungsberichten zu Depressionen interessiert seid, dann folgt nun noch eine kleine Liste ohne Wertung oder Anspruch auf Vollständigkeit:
„Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben“ von Till Raether
„Drüberleben: Depressionen sind doch kein Grund, traurig zu sein“ von Kathrin Weßling
„Wenn das noch geht, kann es nicht so schlimm sein“ von Benjamin Maack
„Minusgefühle“ von Jana Seelig
„Morgen ist leider auch noch ein Tag: Irgendwie hatte ich von meiner Depression mehr erwartet“ von Tobi Katze
„Frank Ocean“ von Sophie Passmann
„Ziemlich gute Gründe, am Leben zu bleiben“ von Matt Haig
Zwischenruf
Danke, gut?
Oder vielleicht doch nicht und alles dazwischen
eine Kolumne von Helene Fuchshuber
29.03.2022 - Ausgabe 81
Über dieser Ausgabe steht das Stichwort Mental Health und mein erster Impuls war es, ganz viel und theoretisch über psychische Krankheiten zu schreiben. Es gab einen mittellangen Text, 845 Wörter, 5358 Buchstaben plus Leerzeichen. Und irgendwie erschienen mir am Ende die Leerzeichen das bestimmende Element zu sein. Denn irgendwie stand nicht viel drin. Ja, wir müssen psychische Krankheiten als Begriff und überhaupt entstigmatisieren. Aber noch mehr müssen wir generell unser Denken über krank und gesund Sein überdenken, denke ich. Und versuche es nochmal.
Wenn er über das Wort gesund nachdenkt, dann denkt er an eine quietschfidele Person, die über eine Wiese tobt. So mein Bruder. Warum also denken wir, wenn wir an und über Mental Health denken, zuallererst an psychische Krankheiten? Vielleicht liegt es daran, dass mentale Gesundheit eben nicht der vorherrschende Normalzustand ist.
Wir haben zwar vielleicht grundsätzlich akzeptiert, dass Menschen krank oder gesund sein können, psychisch oder physisch, aber unsere Wunschvorstellung oder die Art, wie wir über Dinge denken, dass sie sein sollten, stimmt nicht mit der Realität überein. Es sind eben nicht erstmal alle gesund, obwohl wir meinen, das zu glauben. Krank Sein ist keine Ausnahme oder Abweichung von der Regel. Und außerdem stehen sich Gesundheit und Krankheit nicht diametral gegenüber. Es gibt kein striktes entweder, von nur krank oder nur gesund, und auch kein striktes oder, von nur psychisch oder nur physischem Wohlbefinden. Um mal eine Ich-Botschaft zu senden: Wenn ich krank im Sinne von erkältet oder so bin, geht’s mir auch seelisch und mental meistens kacke.
Vielleicht liegt es also daran, dass wir, auch wenn wir viel über die Entstigmatisierung psychischer Krankheiten sprechen, davon ausgehen, dass grundsätzlich alle gesund sind. Aber es eben nicht wirklich tun. Nicht wirklich an unsere eigenen Gedanken glauben. Steile Hypothese.
Vier meiner engsten Freund:innen sind in psychologischer bzw. psychotherapeutischer Behandlung. In Anbetracht der Tatsache, dass ich nicht so wahnsinnig viele enge Freund:innen habe, sind das zwischen 50% und sogar mehr. Wenn ich so darüber nachdenke, finde ich das krass. Nicht krass im Sinne von total heftig oder unvorstellbar oder irgendwie abgespaced. Aus unterschiedlichen Gründen, in unterschiedlichen Sinnen. Ein bisschen finde ich es krass, weil ich es so nicht-krass finde, weil es mir so „normal“ vorkommt. Ich hasse das Wort normal, aber in Ermangelung eines besseren… Ich finde es krass, wenn ich daran denke, dass die vier ja nur stellvertretend halt die vier sind, die ich kenne. Dass es so viel mehr Menschen gibt, denen es (psychisch) nicht gut geht. Ich finde es daran anschließend weiterhin krass, dass psychische Gesundheit immer noch von so vielen Menschen nicht ernst genommen wird. Und dass der Zugang zu Betreuung und Hilfe immer noch so verdammt schwer ist. Ich finde es krass, wenn ich daran denke, dass die vier ja eigentlich Positivbeispiele sind in dem Sinn, dass sie in Behandlung sind, und dann finde ich es noch krasser, wenn ich an die Größe der „Dunkelziffer“ denke.
»Eigentlich will ich dafür plädieren, dass es nur eine ganze Gesundheit gibt «
Wir begeben uns in ärztliche Behandlung, wenn uns etwas wehtut, wir einen Unfall hatten, irgendwas Körperliches nicht (mehr) so funktioniert, wie es soll. Wir suchen uns Hilfe, damit es uns besser geht. Es gibt zig medizinische Spezialisierungen, für jedes körperliches Wehwehchen Spezialist:innen. Ich möchte übrigens die eine Gesundheit gar nicht über die andere stellen. Eigentlich will ich dafür plädieren, dass es nur eine ganze Gesundheit gibt (siehe meine Ich-Botschaft von vorhin). Aber die Realität schreit ja förmlich danach, dass es mehr Plätze für Menschen, denen es psychisch nicht gut geht, geben muss. Aber Psychotherapeut:innen bemühen sich halt ungefähr genauso hart um Kassenplätze – von denen es nach einem Schlüssel aus dem Jahr 1999 in Anbetracht des steigenden Bedarfs schlicht zu wenige gibt – wie Patient:innen um Therapeut:innen. Und dann wird den Psychologie Studis oder auch Therapie Studis das Leben auch noch so schwer gemacht, dass die eigentlich vor eigener Arbeit erstmal selbst therapiert werden müssten. Aber ich schweife ab, das ist ein anderes Thema.
Zurück zur mentalen Gesundheit. Selbst wenn offener über das Thema psychischer Erkrankungen gesprochen wird, kommt manchmal die Gesundheit noch zu kurz. Ich habe oben schon angerissen, dass Gesundheit und Krankheit nicht unbedingt einander ausschließende Gegensätze sind. Zurück zu den Ich-Botschaften: Ich bin gesund. Ich hatte gestern trotzdem einen beschissenen Tag und mir ging es nicht gut. Nicht weil etwas grundsätzlich falsch gelaufen ist, nicht weil irgendwas Doofes passiert ist. Einfach, weil ich platt war, sich viele blöde Gedanken angesammelt haben und andersherum nichts wirklich Gutes passiert ist. Jammern auf hohem Niveau. Aber letztlich ist Mental Health oder Gesundheit generell eben ein allumfassendes Thema.
Irgendwo weiter oben habe ich mal das Wort Wohlbefinden benutzt – ich meine das englische wellbeing, hab versucht, das eins zu eins zu übersetzen. Nunja. Ich glaube, darum geht es am Ende. Um wellbeing. Darum, dass es Menschen rundherum gut geht. Und darum, dass die Unterscheidung beziehungsweise vielmehr die unterschiedliche Bewertung der Ebenen, auf denen es Menschen gut oder schlecht oder alles dazwischen gehen kann, irgendwann wegfällt.
Und jetzt habe ich doch auch wieder etwas viel theoretische Gedanken versucht aufzuschreiben. Wo ich eigentlich am Anfang hinwollte: Um Himmels Willen, wir müssen nicht immer auf jedes „Wie geht’s dir?“ ehrlich antworten. Wir können andere manchmal getrost mit einem „Danke, gut.“ abspeisen. Manchmal interessiert es unser Gegenüber eh nicht. Aber an anderen manchmals lohnt es sich, die Frage ehrlich zu beantworten. Und sei es vor sich selbst. Damit wir checken, wenn es nicht gut ist und warum es nicht gut ist. Und damit wir irgendwann fröhlich und ehrlich sagen können „Danke, gut.“

Helene Fuchshuber
antwortet selbst auch ziemlich häufig einfach nur mit „gut“ auf die Frage wie`s ihr geht. Aber sie versucht das zu ändern, jedenfalls an Stellen, an denen es sich lohnt. Wenn eure Antwort auf die Frage nicht nur oberflächlich, sondern eigentlich immer oder jedenfalls zu oft „nicht so gut“ lautet, dann – auch wenn das leichter gesagt als getan ist – sucht euch Hilfe! Erste Anlaufstellen findet ihr bei der Psycho-Sozialen Beratungsstelle des AStA oder auch bei der Psychologischen Beratungsstelle des Studierendenwerks.