
Editorial

Liebe Leser:innen,
Kurios, wie das Wort vollendet sich in seiner Benutzung so krass voneinander unterscheidet. Ein Sonnenuntergang kann von vollendeter Schönheit sein. Allein die Aneinanderreihung „von vollendeter Schönheit“ finde ich vollendet schön. Aber schon so ergibt das kaum noch Sinn. Gegenüber von vollendeter Schönheit stehen vollendete Tatsachen und meist werden Menschen vor vollendete Tatsachen gestellt und selten ist das besonders schön.
Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt und müssen deshalb euch hiermit vor vollendete Tatsachen stellen: Das FW-Referat des AStA wurde im Zuge von Sparmaßnahmen und nach Evaluierung seines Werts für den AStA – anscheinend wertlos, oder wenigstens nicht wertvoll genug – gestrichen.
Statt einer Zeitung von und für Studierende soll es in Zukunft wieder eine Zeitung von und für den AStA geben. Ohne einen Großteil von uns.
Wir sind traurig und sauer, aber auch immer noch motiviert. Wir versuchen eine Lösung dafür zu finden, weiterhin zu schreiben, zu informieren, zu diskutieren, schlicht regelmäßig ein Magazin auf die Beine zu stellen. Noch wissen wir nicht, wie, aber die Daumen sind gedrückt und die Köpfe rauchen.
Im Zweifel bis dahin, in altem oder neuem Gewand und jetzt und hier erst mal viel Spaß beim Lesen!
Eure FW Redaktion
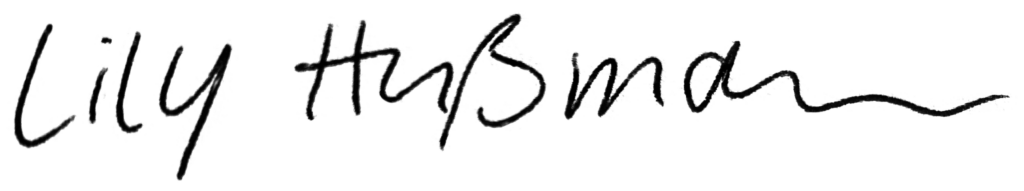
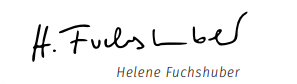
Helene Fuchshuber und Lily Hußmann, Chefredakteurinnen
Inhalts-verzeichnis
Universität/Hochschulpolitik
Chronologie des Endes des FW
Universität/Hochschulpolitik
Wie die AStA die Auflösung des FW rhetorisch rechtfertigt
Universität/Hochschulpolitik
Kein Sachzwang
Universität/Hochschulpolitik
Gastartikel zur Auflösung eines anderen Referates
Kultur
Wie sich der Untergang anfühlen kann – Zwei Filme im Vergleich
Gesellschaft
The dark side of going to [insert here tourist city name]
Gesellschaft
Das Energiegeld ist da. Endlich.
Gesellschaft
vom Urlaubsgefühl bis in die Realität
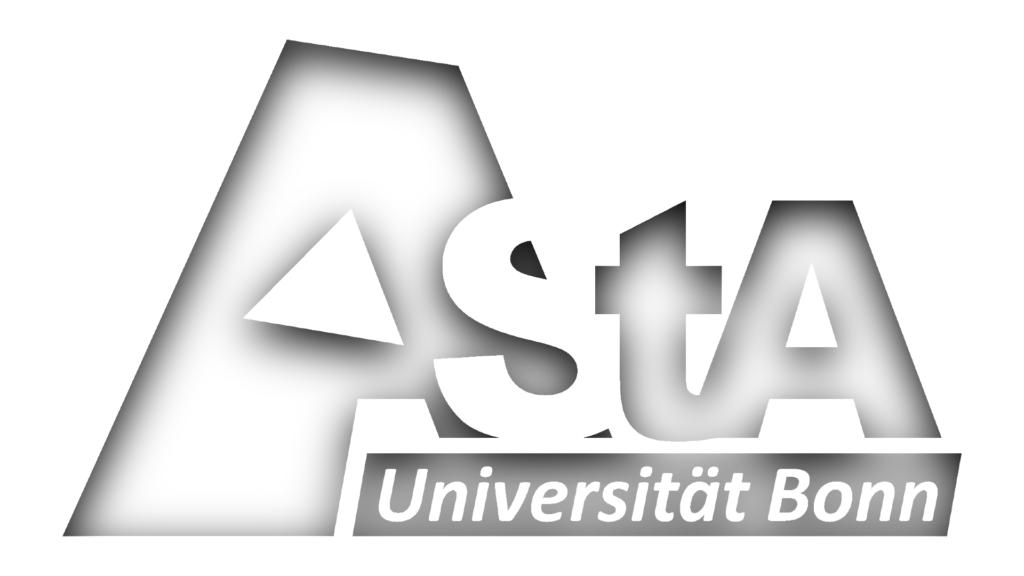
Disclaimer!
Die nachfolgenden Kommentare zur Auflösung des Friedrichs Wilhelm zielen nicht darauf ab, dem AStA – vertreten durch den Vorsitz – zu schaden. Sie versuchen beispielsweise nicht, das Handeln des Vorsitzes mit dem Handeln führender Politiker:innen und Minister:innen sachlich gleichzusetzen, sondern vielmehr eine bestimmte, häufig implizit vorausgesetzte rhetorische Form offenzulegen und zu kritisieren, die in politischen Diskursen allerorts Anwendung findet. Wenn es zum Ende von Die Rhetorik der politischen Notwendigkeit heißt, „dass eine grundlegende Reform der Hochschulpolitik dringend vonnöten ist“, dann geschieht dies nicht aus Missachtung gegenüber der Studierendenvertretung, sondern ganz gegenteilig in Hochachtung gegenüber ihrem wertvollen Engagement und dem Prinzip, das diesem Engagement zugrunde liegt: Der Demokratisierung der Universität als zwischenmenschlichem Raum. Damit verbunden ist die Hoffnung auf eine Ausweitung dieser Demokratisierung, sodass die Politik einmal vollständig Politik wird und an die Stelle des Verwaltens tritt.
Abkürzungen:
AStA – Allgemeiner Studierendenausschuss;
FW – [Des] Friedrichs Wilhelm;
GO – Geschäftsordnung;
AE – Aufwandsentschädigung;
SP – Studierendenparlament;
GAS – Gesamt-AStA-Sitzung
Einleitung
Rekonstruktion der Dekonstruktion
Die Umstände der Abschaffung des FW
von Lily Hußmann
18.04.2023 - Ausgabe 90
Wie ihr, liebe Leser:innen, vermutlich beim Aufschlagen dieser Ausgabe bereits festgestellt habt, haltet ihr gerade die vorerst letzte FW in den Händen. Dementsprechend möchten wir diese Ausgabe zwar zum einen zum Abschied nutzen, zum anderen aber auch dokumentieren und kommentieren, wie es zur Auflösung unseres Referats gekommen ist, weshalb wir einen großen Teil dieser Ausgabe ebendiesem Vorhaben gewidmet haben. Auf den nächsten Seiten könnt ihr sowohl das offizielle Statement des AStA-Vorsitzes als auch zwei Kommentare aus unserer Redaktion lesen. Außerdem gibt es einen Text von Debora aus dem Referat für Politische Bildung, das im Zuge der Sparmaßnahmen ebenfalls aufgelöst und in Form einer Projektstelle ans Referat für Öffentlichkeit angegliedert wurde. Uns ist klar, dass unsere Durchschnittsleser:innen wahrscheinlich wenig bis gar keinen Einblick in die Hochschulpolitik und die Strukturen des AStA haben. Damit die folgenden Texte für euch also ein wenig nachvollziehbarer werden, kommen hier erstmal die harten Fakten.
Die Chefredaktion des FW wird (oder eher: wurde) laut AStA GO jedes Jahr sechs Wochen nach der AStA Wahl auf der GAS neu gewählt, wobei die jeweilige Person auch als Referent:in des FW-Referats fungiert und vom SP bestätigt werden muss. Noch im Februar gingen wir davon aus, dass das auch diesmal regulär wieder geschehen würde. Am 16.02. erhielten wir dann eine Mail, in der sich der (ehemalige) AStA-Vorsitz für ein Gespräch auf unserer nächsten Redaktionssitzung ankündigte. Natur und Anlass des Gesprächs wurden vorher nicht kommuniziert, sodass wir uns darauf nicht vorbereiten konnten. Was uns dann auf unserer Sitzung am 23.02. von der Vorsitzenden und dem Finanzreferenten mitgeteilt wurde, war Folgendes: der AStA müsse im nächsten Haushaltsjahr extreme Einsparungen vornehmen und wir würden als teuerstes Referat davon am stärksten betroffen sein. (Die Gründe für die extremen Sparmaßnahmen kommentiert Clemens in seinem Artikel.) Unsere Druckkosten sollten restlos gestrichen und unsere AE (= Aufwandsentschädigung)-Stellen von fünf auf zwei reduziert werden. Uns wurde angeboten, Vorschläge für Sparmaßnahmen an anderer Stelle zu machen, wofür wir um Einsicht in die Berechnungen des Finanzreferenten gebeten haben, welche uns nie gewährt wurde. Außerdem wurde seitens des Vorsitzes der Wunsch nach mehr Berichten aus dem AStA geäußert. Der FW soll also zum Sprachrohr des AStA umfunktioniert werden. Durch diese Maßnahmen ist der FW in seiner jetzigen Form effektiv arbeitsunfähig.
Nach diesem Gespräch gingen wir – da uns nichts Gegenteiliges gesagt wurde – davon aus, dass wir bis Ende des Haushaltsjahres noch regelmäßig erscheinen könnten und unsere AE bis dahin ausgezahlt bekämen. Erst auf Nachfrage wurde uns am 22.03. während der Sitzung des SP, auf der ein neuer AStA Vorsitz gewählt wurde, per Mail mitgeteilt, dass a) keine neue Chefredaktion gewählt werden würde, b) ab März keine AE mehr ausgezahlt würden und c) die Ausgabe 90 unsere letzte sein würde. Das stieß bei uns natürlich erstmal auf Ärger, aber vor allem absolutes Unverständnis, weshalb wir den neuen AStA-Vorsitz um ein offizielles Statement gebeten haben:
Liebe Leser*innen der FW, liebe Redaktionsmitglieder,
mit großem Bedauern müssen wir als AStA euch leider mitteilen, dass dies die vorerst letzte Ausgabe der “Des Friedrichs Wilhelm”, wie ihr sie in den letzten Jahren kennengelernt habt, sein wird.
Aufgrund der angespannten finanziellen Lage, die wir aufgrund der 49 €-Ticket-Problematik, den sinkenden Studierendenzahlen und der Tariflohnerhöhungen im nächsten Semester erwarten, sowie der Inflation müssen wir als AStA enorm Geld einsparen, um unseren normalen Geschäftsbetrieb, die Bezahlung unserer Festangestellten, die Beratungen für euch und die politische Arbeit in den Referaten aufrechterhalten zu können.
Die FW als AStA-Magazin erhält seit Jahren einen großen finanziellen Titel, in dem sich knapp 30.000 € befinden, und aufgrund der steigenden Druckkosten muss dieser Betrag in Zukunft voraussichtlich nochmal erhöht werden.
Die Entscheidung, das Magazin in dieser Form nicht mehr so weiter zu finanzieren, ist uns absolut nicht leichtgefallen und wurde viel und lange diskutiert.
Letzten Endes werden alle politischen Referate des AStA weniger Geld und Personal zur Verfügung haben und es wird eine herausfordernde Zeit für uns alle. Die autonomen Statusgruppen-Referate (Queer-Referat, BIPoC-Referat, die Referate für Frauen & Geschlechtergerechtigkeit und für internationale Studierende) bleiben von den personellen Kürzungen verschont, damit sie in Zukunft weiterhin die Interessen ihrer jeweiligen Statusgruppe angemessen vertreten können.
Wir hätten uns alle gewünscht, dass es nicht so weit kommen muss, aber sehen keinen anderen Lösungsweg.
Ein AStA-Magazin wird es aber weiterhin geben! Es wird in einer kleineren Auflage und nicht mehr monatlich erscheinend aus dem AStA berichten und euch so auf dem Laufenden halten, was aktuelle hochschulpolitische Themen betrifft.
Wir bedanken uns bei allen Redaktionsmitgliedern der letzten Jahre für ihre kreative, kritische und politische Arbeit und wünschen ihnen alles Gute für die Zukunft!
Janna, Katrin und Vasco
Euer AStA-Vorsitz

Lily Hußmann
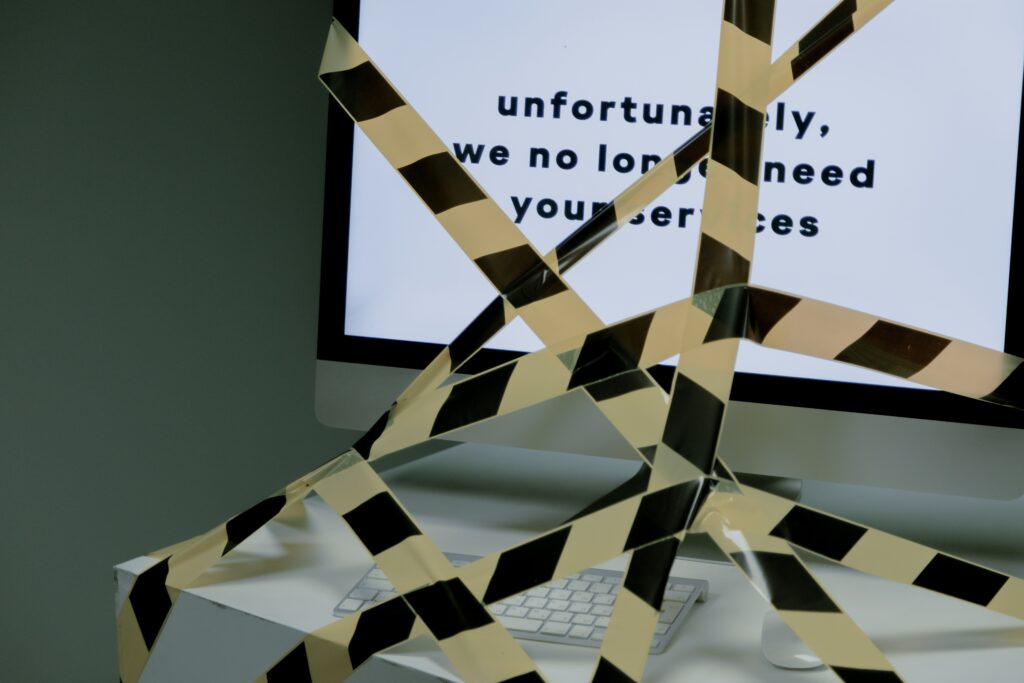
Kommentar
Die Rhetorik der politischen Notwendigkeit
Ein Kommentar zu dem Statement des AStA bezüglich der Abschaffung des FW
von David Winterhagen
18.04.2023 - Ausgabe 90
Wenn immer in der Politik von Notwendigkeiten die Rede ist, sollte man hellhörig werden. Das liegt ganz einfach daran, dass politische Prozesse nicht kausal determiniert sind, sondern einen demokratischen Raum der Freiheit konstituieren, in dem verschiedene Akteur:innen über die Einrichtung des Gemeinwesens streiten. Jeder Streitgegenstand, der in diesem Raum erscheint, zieht nicht etwa eine allein richtige Strategie nach sich, sondern vereint in sich eine beinahe unbegrenzte Vielzahl an möglichen politischen Handlungsweisen. Das Bestreben führender Köpfe ist es daher stets, ihre persönliche Handlungsweise als die einzig mögliche zu verkünden. Zu diesem Zweck schließen sie den politischen Streit um den Gegenstand durch den Verweis auf vermeintliche Notwendigkeiten. Ein solcher Verweis macht rhetorische Kniffe notwendig, die allzu häufig an der Sachlichkeit der Sache vorbeigehen. Um ein Beispiel zu nennen: Am 15. März saß Christian Lindner bei Maischberger, um seine Blockade der Kindergrundsicherung damit zu verteidigen, dass er auf die ‚Tatsache‘ verwies, dass die Staatskassen nun einmal leer seien. Auf die kritische Nachfrage, warum es denn nicht möglich sei, wie im Falle der Bundeswehr eine Art schuldenfinanziertes Sondervermögen einzurichten, führte Lindner die strenge Unterscheidung zwischen Investitionen und Ausgaben ein. Im Gegensatz zu Ausgaben würden Investitionen dafür sorgen, dass auf lange Sicht wieder Geld zurück in die Kassen fließt. Inwiefern ein solch privilegierter Status für die Bundeswehr gilt, nicht aber für eine Kindergrundsicherung, die Millionen von Kindern aus der Armut befreien würde, um ihnen eine Chance in dieser Gesellschaft zu verschaffen, bleibt bei Lindner offen.
Doch was für den Makrokosmos der Bundespolitik gilt, spiegelt sich auch im Mikrokosmos der Universität. Das zeigt Debora in ihrem Kommentar zur Auflösung des Referats für politische Bildung durch den AStA, wenn sie darüber schreibt, dass die Universität „kein von der Gesellschaft oder Politik abgeschlossener Raum [ist]“, sondern die Prägung desselben ideologischen Stempels trägt, der die Gesellschaft im Ganzen markiert. Wie die bundespolitische Rhetorik der scheinbaren Notwendigkeit auch in universitären Kontexten Anwendung findet, lässt sich wunderbar anhand des Statements des AStA zur Abschaffung auch unserer Zeitschrift nachvollziehen, das dieser letzten Ausgabe beigefügt ist. Darin finden sich seitens des neuen Vorsitzes so schöne Kniffe wie: „Wir hätten uns alle gewünscht, dass es nicht so weit kommen muss, aber sehen keinen anderen Lösungsweg“, die sich auf demselben Niveau bewegen wie Lindners „Entschuldigung, dass ich da der Spielverderber bin, aber es gibt keine andere Möglichkeit“.
Alternativlose Alternativen
Typisch für eine solche, das eigentliche politische Vorhaben verschleiernde Rhetorik ist auch das Anbieten von Alternativen, die gar keine sind. So geht aus dem Schreiben hervor, dass es weiterhin ein AStA-Magazin geben würde, wodurch eine Äquivalenz zwischen dem ‚alten‘ und dem ‚neuen‘ Magazin nahegelegt wird, die überhaupt nicht besteht. Außer der finanziellen Abhängigkeit vom AStA, die angesichts der neuesten Entwicklungen wohl kaum wünschenswert ist, haben beide Magazine nichts miteinander gemein. Denn das ‚neue‘ Magazin wird allem Anschein nach als bloßes Sprachrohr des AStA fungieren und damit genau die politische Unabhängigkeit einbüßen, die unser Magazin im Kern ausgemacht hat. Damit geht auch die kritische Distanz und der besondere Blickwinkel verloren, die einer solchen Unabhängigkeit schon im universitären Kontext innewohnen, und die im gesellschaftlichen Kontext für eine lebendige Öffentlichkeit unentbehrlich sind. Wie kritisch und lebendig das trockene Herunterrattern irgendwelcher AStA-Beschlüsse in Artikelform tatsächlich sein wird, bleibt abzuwarten. Fest steht, dass dem vorigen wie auch dem aktuellen Vorsitz ein kollektiv finanziertes, aber politisch unabhängiges und kritisches Medium nicht wichtig genug ist, um alternative Mittel und Wege zu suchen, es beizubehalten. Diese eigens gesetzte politische Intention lässt sich nun mal nicht vollends durch eine Rhetorik der Notwendigkeit und Ausflüchte verdecken.
»“Während also der AStA den professionellen Politiker:innen in dem Versuch, demokratische Prozesse rhetorisch zu schließen in nichts nachsteht, erweist er sich in dem Versuch, demokratische Prozesse insgesamt zu umgehen, noch als deutlich ›professioneller‹.”«
Strenge Unterscheidungen
Dieser Reihe beliebter rhetorischer Kniffe lässt sich analog zu Lindner auch das Ziehen von Unterscheidungen hinzufügen, die so einfach gar nicht zu ziehen sind. Es ist richtig und wichtig, dass die autonomen Referate von den Kürzungen verschont bleiben, damit sie weiterhin die Interessen derjenigen vertreten können, die sie repräsentieren, wie der AStA in seinem Statement hervorhebt. Doch eine markante Unterscheidung zwischen den autonomen Referaten auf der einen Seite und dem FW auf der anderen Seite, setzt voraus, dass letzteres eine solche Interessenvertretungsrolle schlichtweg gar nicht wahrnimmt. Ein Blick in unsere Archive genügt jedoch, um das zu widerlegen. Das FW hat in seinen kritischen Interventionen stets die Interessen gesellschaftlich wie universitär benachteiligter Gruppen in den Fokus genommen, sei es in Form von einzelnen Artikeln oder ganzen Themenausgaben. Bereits geplante Projekte dieser Stoßrichtung, wie die Offenlegung und Anklage eines sich regelmäßig homophob äußernden Ökonomie-Professors, können nun leider nicht mehr realisiert werden. Darüber hinaus hat der FW als ein Multiplikator für die Arbeitsergebnisse anderer Referate fungiert: Es ist immer möglich gewesen, Texte der autonomen Referate über uns verbreiten zu lassen. Das Ziehen solch strikter Grenzen zwischen den verschiedenen Referaten würde daher eine ausführlichere Begründung seitens des Vorsitzes erfordern – zumindest angesichts der existentiellen Konsequenzen, die diese Grenzziehung zur Folge hat.
Milde Versicherungen
In seinem Schreiben versichert uns der Vorsitz außerdem, dass über die Abschaffung des FW „viel und lange diskutiert [wurde]“ – womit der Reihe der rhetorischen Manöver abschließend die Krone aufgesetzt wird. Schließlich muss diese Polit-Floskel eine bloße Versicherung bleiben, solange die vielen und langen Diskussionen hinter verschlossenen Türen stattfinden. Denn das Politische ist allgemein dadurch gekennzeichnet, dass ein wesentlicher Anteil des Streits über seine Gegenstände öffentlich stattfinden muss – etwa in Parlamenten oder Medien – um Interventionen anderer Akteure zu ermöglichen. Diesem demokratischen Ideal wird die Wirklichkeit nicht immer gerecht. Gerade auf professioneller, bundes- oder landespolitischer Ebene findet die Beratschlagung der Regierenden meist außerhalb des Lichtkegels der Öffentlichkeit statt. Doch normalerweise werden die im ‚Dunkeln‘ erörterten Ergebnisse im Anschluss rechtzeitig offengelegt, damit sie von einer breiten Öffentlichkeit kritisiert und diskutiert werden können, bevor sie parlamentarisch per Gesetzgebung verabschiedet werden. Dabei werden besonders die Perspektiven der von den geplanten Vorhaben betroffenen Akteur:innen berücksichtigt. Diese generelle demokratische Praxis kam in unserem konkreten hochschulpolitischen Fall nicht zum Zuge: Wie Lily in ihrer Rekonstruktion der Geschehnisse darlegt, wurden wir nach ein paar vagen Vorankündigungen unversehens mit einer saloppen Mail über die hinter vorgehaltener Hand beschlossene Abschaffung des FW abgespeist, ohne dass uns die Möglichkeit gegeben wurde, uns überhaupt in den Diskussionsprozess einzuschalten.
Während also der AStA den professionellen Politiker:innen in dem Versuch, demokratische Prozesse rhetorisch zu schließen, in nichts nachsteht, erweist er sich in dem Versuch, demokratische Prozesse insgesamt zu umgehen, noch als deutlich ‚professioneller‘. Die urplötzliche Beseitigung eines öffentlichkeitswirksamen, politisch unabhängigen, kritischen und studentischen Magazins per Dekret von oben führt das vor. Dafür verantwortlich ist ausgerechnet eine mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung von 9,6 % am wenigsten legitimierte Studierendenvertretung. Die unter demokratischen Gesichtspunkten unsichere Lage des AStA deutet daraufhin, dass eine grundlegende Reform der Hochschulpolitik dringend vonnöten ist. Andernfalls bereitet sich auf universitärer Ebene bereits das vor, was auf höheren politischen Ebenen stets droht: Die Schließung des demokratischen Streits durch den Verweis auf neutrale Notwendigkeiten. Oder mit anderen Worten: Die Abschaffung der Politik durch die Technokratie.

David Winterhagen
Kommentar
Fragwürdige Abwicklung
- kein Sachzwang
von Clemens Uhing
18.04.2023 - Ausgabe 90
Dass die neue AStA-Koalition aus Grüner Hochschulgruppe, Jusos und Liste Poppelsdorf „Des Friedrichs Wilhelm“ vorläufig auflöst, ist eine politische Entscheidung, die grundsätzlich rechtfertigbar ist. Selbstverständlich können die Koalitionäre und die von ihnen beauftragten Verantwortlichen der Ansicht sein, dass in Zeiten finanzieller Anspannung das letzte und inhaltlich weitgehend unabhängige Bonner Studierendenmagazin am Boden der Prioritätenliste studentischer Selbstverwaltung steht. Im Sinne eines ehrlichen Umgangs miteinander, lässt die Art der Begründung und der Abwicklung allerdings zu wünschen übrig. Argumentiert wird in erster Linie mit dem eingeschränkten finanziellen Spielraum der verfassten Studierendenschaft im nächsten Jahr. Wegen des kommenden 49-Euro-Tickets werden sich bis ins Wintersemester 2023/24 5.000 sogenannte „Ticketstudierende“ exmatrikulieren, so die Annahme der Verantwortlichen. Gegenüber der FW wurde diese Zahl keinesfalls sachlich evidenzbasiert begründet, vielmehr klang es nach einer aus der Luft gegriffenen Schätzung. Allein schon, weil unter „Ticketstudierenden“ auch solche passiven Studierenden gefasst werden, die wegen der Familienversicherung oder des Kindergelds eingeschrieben sind, dürfte die Zahl derer, die wegen des 49-Euro-Ticket abspringen, wesentlich kleiner sein, als von der Koalition angenommen. Diese nimmt weiter nach einem Blick in die Glaskugel an, dass auf den AStA nach Abschluss der Verhandlungsrunde des TV-L Mehraufwendungen für Personal von 10 % im Jahr anfallen werden. Auch hier bleibt offen, welche Evidenz für eine solche Schätzung herangezogen wird.
Nun mag man es für grundsätzlich sinnvoll erachten, eher konservativ zu rechnen und sich später über ein Plus zu freuen, statt durch fehlgeleiteten Optimismus in die roten Zahlen zu rutschen. Doch selbst dann ist das zumindest vorläufige Einstampfen der FW nicht alternativlos. Es ist nachvollziehbar, dass insbesondere die hohen Druckkosten in der gegenwärtigen Lage kaum rechtfertigbar sind. Deren ersatzlose Streichung würde schon Kosteneinsparungen von circa 2/3 im Haushaltstitel der AStA-Zeitschrift bedeuten. Den Verantwortlichen des Vorsitzes und der Koalition reicht dies nicht: Auch die Aufwandsentschädigungen, die eine zuverlässige und konstante Arbeit der Redaktion unterstützen, werden schon vor Ablauf des Haushaltsjahres nicht mehr ausgezahlt. Informiert wurde darüber nur zwei Wochen im Voraus. Redaktionsmitglieder, die seit Jahren unter Einsatz von zig Stunden monatlicher Arbeit das regelmäßige Erscheinen der FW sicherstellen, kriegen vom einen auf den anderen Monat keine Zahlungen mehr, mit denen sie aus guten Gründen zumindest bis Ende des Haushaltsjahres im Juni rechnen konnten. Abgesehen davon, dass ein solch plötzliches finanzielles Austrocknen im zwischenmenschlichen Umgang mindestens fragwürdig ist, zerstören die Verantwortlichen des AStA und der Koalition damit – ähnlich wie beim PolBil – in Windeseile gewachsene und funktionierende Strukturen. Alternativ wäre es möglich gewesen, den von den Studierenden semesterweise gezahlten AStA-Beitrag ein Stück weit mehr zu erhöhen, um das vermeintlich entstehende Haushaltsdefizit auszugleichen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Während eine Beitragserhöhung im Falle einer besseren finanziellen Lage jederzeit rücknehmbar ist, kommen die nun zerschlagenen Strukturen so schnell nicht wieder. Die Verantwortlichen erweisen der politischen Arbeit des AStA und kritischem Journalismus somit ohne Zwang einen Bärendienst.
Dazu noch eine Anmerkung aus dem Kabinett bürokratischer Spitzfindigkeiten: Die dekretierte Auflösung der FW meinen die Verantwortlichen dadurch vorgenommen zu haben, auf der letzten Sitzung des Studierendenparlaments schlicht keine Chefredaktion/Referent:in mehr gewählt zu haben. Tatsächlich ist das der „normale“ Ablauf zur Abschaffung eines AStA-Referats. Die FW ist allerdings kein einfaches Referat, sondern auf besondere Weise durch die Geschäftsordnung des AStA institutionalisiert. In §12 ist geregelt, dass der AStA „seine eigene Zeitung“ hat, deren Redaktionsmitglieder sechs Wochen nach der AStA-Wahl durch die Gesamt-AStA-Sitzung gewählt werden. Diesen, durch die Geschäftsordnung vorgeschriebenen Wahlprozess, schlechthin nicht mehr anzustoßen, dürfte unrechtmäßig sein. Korrekterweise hätte die Auflösung der FW durch eine Änderung der Geschäftsordnung beschlossen werden müssen.
Angesichts der vollendeten Tatsachen bleibt zu bedauern, dass die Koalition und ihre Vertreter:innen im AStA zu wenig Wertschätzung gegenüber studentischem Journalismus und seinen Mitarbeitenden aufbringen können, um ihre politische Entscheidung, ihn abzuschaffen, ehrlich zu kommunizieren und sauber abzuwickeln. Im Vorausblick bleibt spannend, welche Pläne die Verantwortlichen bzgl. der FW verfolgen und ob diese tatsächlich in ein „Sprachrohr“ des AStA umgewandelt werden wird. Es ist zu hoffen, dass es trotz der vorauseilenden Sparwut in Zukunft noch Berichtenswertes über den AStA gibt.

Clemens Uhing

Auflösung des Referates für politische Bildung
Zur Möglichkeit der Kritik und Emanzipation an der Universität
von Deborah Eller (ehem. Referentin für Politische Bildung)
18.04.2023 - Ausgabe 90
Siebzehn Jahre lang stellte ein Zusammenschluss der Hochschullisten den AStA, welcher immer die die GHG, Juso-HSG und die LUST beinhaltete. Nach der 45. Wahl des Studierendenparlamentes lösten die GHG und Juso-HSG diese Zusammenarbeit auf. An Stelle der LUST ist nun die Liste Poppelsdorf (LP) getreten. Eine Folge dieser neuen Koalition ist die Abschaffung des Referates für politische Bildung. Zum Abschied wird hier geschaut, was das bedeutet und wie es soweit kommen konnte.
Erst einmal Grundsätzliches: Der Stachel der Kritik muss immer wieder genau dort wehtun, wo Parteikarrierist:innen und leidenschaftlich bürokratische Parlamentarier:innen nicht hinsehen wollen, beziehungsweise ihnen das kritische Rüstzeug fehlt, um die Ursachen gesellschaftlicher Missstände in deren Bedingtheit durch die Totalität ökonomischer Sachzwänge zu erkennen. Wer nicht dazu fähig ist, eine Gesellschaftsanalyse aus einer Position heraus anzustellen, welche sich selbstreflexiv auf das eigene Denken bezieht und so ideologische Doxa erkennen und kritisieren kann, wird auch nicht die Notwendigkeit einer konsequenten politischen Positionierung als AStA einsehen können, welche über Kommentare zu tagesaktueller Realpolitik hinausgeht.
Die Trennung von hochschulbezogenen Aktivitäten und politischem „Engagement“ ist eine ebenso dysfunktionale wie illusorische Mär. Das studentische Leben — das erfahren wir alle tagtäglich — ist geprägt von der Neoliberalisierung der Hochschulen, welche selbst durch instrumentelle Vernunft und kapitalistische (Selbst-)Ausbeutungsverhältnisse geprägt ist. Die Universität tut heute häufig nicht viel mehr, als aus Studierenden effiziente und gleichförmige Arbeitskraftmodule zu fertigen. Dem Abbau jeglicher emanzipatorischer Möglichkeitsräume an den Universitäten, der vor allem seit der Bologna-Reform stark voranschritt, ist nicht durch lupenreine Hochschulpolitik beizukommen, die den zweiten Teil ihres Kompositums häufig nur als Dekoration zu verstehen scheint. Wie hier erkennbar wird, ist die Universität kein von der Gesellschaft oder Politik abgeschlossener Raum, weswegen vor allem das politische und aktivistische Engagement einiger AStA-Mitglieder so essenziell für eine entschiedene Inanspruchnahme unseres politischen Mandates als Studierendenschaft ist. Die isolierte Betrachtung einzelner Gegenstände hingegen, welche höchstens reformiert werden, reicht nicht aus, um eine emanzipatorische Bildungspolitik und die Möglichkeit der Herausbildung eines kritischen mündigen Geistes zu stärken.
»“Während von studentischer Seite aus viele Jahre gegen die Entpolitisierung der Universitäten angekämpft wurde, wird der Abbau einer kritischen studentischen Stimme nun seitens des AStA selbst befeuert.”«
Rechtskonservative, Antisemit:innen, Verschwörungsideolog:innen und „Lebensschützer:innen“ unter den Professor:innen, rassistische Vorfälle, sexualisierte Übergriffe… Das alles sind keine zufälligen Einzelfälle, deren Skandalisierung durch performte Empörung ausreichend wäre. Diese Vorfälle und Gegebenheiten liegen in letzter Instanz in einem gesamtgesellschaftlichen Status quo begründet, in welchem die Totalität eben jener Gesellschaft als stets existierende Präsenz der Herrschaft überall in die Subjekte hineinwirkt. Diese Subjekte, also wir alle, werden somit unter einen Verblendungszusammenhang innerhalb dieser falschen Verhältnisse gestellt, dem nur durch eine Erkenntnis dieser Totalität und letztendlich Auflösung der Verdinglichung des eigenen Lebens beizukommen ist. Daher braucht es eine materielle Kritik der Verhältnisse, welche von der Einsicht begleitet wird, dass wir uns über die Ursachen unseres individuell gefühlten Leidens zunächst irren können: Denn dieses Leiden ist ein kollektives — und keine persönliche Verfehlung —, welches in allen Lebensbereichen, also auch an der Universität, spürbar ist. Der Wunsch nach einem menschenwürdigen Leben in einer emanzipierten Gesellschaft beruht dabei auf der Erkenntnis, dass eben jenes Leben derzeit durch menschliches Handeln verhindert wird, somit aber auch durch eine Änderung dessen ermöglicht werden kann und muss. Dabei reicht es nicht aus, sich unkritisch mit Begriffen wie „Diversität“, „Nachhaltigkeit“ und „Feminismus“ zu schmücken, wie es selbst die Univerwaltung schon dort tut, wo es aus Imagegründen opportun ist. Die kleinteilige Verhandlung von Missständen über einzelne Probleme konstruiert, stellt zu häufig eine entpolitisierte Vereinnahmung unserer Kritik dar, welche uns beispielsweise personelle Repräsentationen von Statusgruppen oder bloße Lippenbekenntnisse gegen Diskriminierungsformen als politische Erfolge präsentieren will. Dabei sollte es uns um mehr gehen, als um oberflächliche Schadensbegrenzung.
So sehr ich — auch an dieser Stelle — die Wichtigkeit des Referates für politische Bildung betone, bin ich gleichzeitig natürlich auch nicht größenwahnsinnig und weiß, dass ein Referat alleine repressive, anti-individualistische Gemeinschaftsideologien und gegenaufklärerische Bestrebungen nicht verhindern kann. Allerdings müssen Möglichkeitsräume für Kritik und Aufklärung bestehen können und verteidigt werden. Politische Bildung ist eines unserer wenigen Instrumente, um für die Möglichkeit eines richtigen Lebens zu kämpfen. Deswegen ist es umso wichtiger, der allgemeinen Tendenz des Abbaus von kritischer politischer Bildung an und in den Universitäten entgegenzuwirken und ihr nicht noch unter unbegreiflichen Rechtfertigungsversuchen Vorschub zu leisten. Während als Begründung drohende Sparmaßnahmen des AStA herhalten müssen, so kann der eigentliche Grund doch nichts anderes sein, als die Geringschätzung für und Gleichgültigkeit gegenüber der Referatsarbeit.
Es mag sein, dass gespart werden muss, dennoch ist das kein Grund dafür, das Referat vor dem Ablauf dieses Haushaltsjahres aufzulösen, womit auch vorab bewilligte Gelder für bereits geplante Veranstaltungen unzugänglich werden. Für den neuen AStA scheint es keine denkbare Option zu sein, mit einer geringen Beitragserhöhung für studentische Zwecke innerhalb des nächsten Semesterbeitrages das Referat, welches schon seit ungefähr zwei Dekaden Bestand hat, regulär am Laufen zu halten. Stattdessen werden alle Referatsmitglieder kurzfristig entlassen und eine Projektstelle für politische Bildung eingerichtet, deren eigener Etat gerade einmal für eine Veranstaltung pro Jahr reichen wird. So wird scheinbar der günstige Moment genutzt, um sich des Referates zu entledigen und somit die Studierendenschaft um eine Erweiterung ihres geistig lückenhaften Lehrangebotes zu bringen. Während von studentischer Seite aus viele Jahre gegen die Entpolitisierung der Universitäten angekämpft wurde, wird der Abbau einer kritischen studentischen Stimme nun seitens des AStA selbst befeuert, welcher die bloße Verwaltung studentischer Belange vorzuziehen scheint. Dieser bedenklichen Entwicklung muss Einhalt geboten werden. Wir müssen uns unsere emanzipatorischen Räume innerhalb der Universität selbst nehmen.
»“Politische Bildung ist eines unserer wenigen Instrumente, um für die Möglichkeit eines richtigen Lebens zu kämpfen.”«

Essay
Melancholie im Frame
Hoffnung und Vernunft am Ende der Welt
von David Winterhagen
18.04.2023 - Ausgabe 90
Während ich diesen Text beginne, stehen die Oscars unmittelbar bevor. Zu diesem Anlass lohnt es sich nochmals auf einen Film zu verweisen, der letztes Jahr gleich vier goldene Trophäen abgesahnt hat – darunter auch die Auszeichnung für den besten Film und das beste Originaldrehbuch. Es handelt sich um Don’t look up von dem US-amerikanischen Regisseur Adam McKay. Der Film dreht sich um eine Doktorandin und einen Professor, die einen Kometen entdecken, der in circa sechs Monaten und vierzehn Tagen auf der Erde einschlagen wird. Mit diesen Fakten konfrontieren sie die US-amerikanische Politik, die jedoch in Gestalt eines weiblichen Trump-Verschnitts alles andere als konsequent mit den Neuigkeiten umgeht. Schließlich nähern sich die Mid-Terms und darauf würde sich eine Kometen-Katastrophe, die droht die ganze Menschheit auszurotten, wohl kaum als machterhaltend auswirken. Als die Präsidentin aufgrund eines anderen Skandals in Bedrängnis gerät, entwickelt sie den grandiosen Plan, den Kometen mit einem Atomschlag abzuwehren. Der Todesklotz enthält jedoch äußerst seltene Rohstoffe, deren gewinnbringende Fährte bereits ein einflussreicher Wirtschaftsmagnat aufgenommen hat. Die Operation wird im letzten Moment gestoppt, um den Abbau zu ermöglichen.
Die beiden Wissenschaftler:innen haben sich indes längst an die Medienöffentlichkeit gewandt, deren aufmerksamkeitsökonomische Prinzipien die Hoffnung auf eine rationale Aufklärung der irrationalen Massen gleichfalls verhindern. Letztere lassen sich lieber von populistischer Politik in Form einer Kampagne voll von alternativen Fakten einlullen: Sieh bloß nicht nach oben, dort gibt es nichts zu sehen! Egal wie gigantisch der Komet für alle sichtbar am Himmel prangt, die Menschheit kann sich nicht zum kollektiven Handeln entschließen und wird endlich vernichtet. Die Botschaft ist klar: Listen to the science, ansonsten gibt es nichts zu hoffen.
Die Unvernünftigen
Man könnte Adam Mckays Film als ein letztes kulturelles Aufbegehren der bestehenden Ordnung im Angesicht ihres Verfalls bezeichnen; ein Aufbegehren, das den wenigen noch „vernünftigen“ Bürgern genau das auftischt, was ihrem Gusto ohnehin entspricht: Jaja, die Trump-Wähler:innen sind alle hoffnungslos verblödet, Politik ist bloß ein populistisches Medienspektakel und die Wissenschaft hat sowieso immer recht. Vermutlich war der Film bei den Oscars deshalb so erfolgreich. Hierbei wird nicht hinreichend klar, dass die Unvernunft der Unvernünftigen das Resultat derselben ideologischen Formation ist, die von der Vernunft der Vernünftigen getragen wird: Mit der Privatisierung der öffentlichen Räume und der Atomisierung der Gesellschaft hat der Neoliberalismus die Bürger ihrer politischen Urteilskraft beraubt. Mit dem Abbau des Sozialstaates hat er sie verarmt. Mit der Technokratisierung der Politik hat er sie entmündigt. Wissenschaftsskeptizismus und Rechtspopulismus sind bloß eine notwendige Folge dieser Logik – und gerade keine fremde, zufällig auftretende Bedrohung. Genau wie der Klimawandel eine notwendige Folge des kapitalistischen Systems ist – und gerade keine fremde, zufällig auftretende Bedrohung in Form eines rasenden Kometen.
Ähnlich und doch ganz anders ist der Ausgangspunkt in Melancholia; ein Film des dänischen Regisseurs Lars von Trier, der 2011 in die Kinos kam und damals leider keinen Oscar gewonnen hat. Auch hier gibt es einen Kometen bzw. diesmal sogar einen ganzen Planeten, dessen apokalyptischer Erdeinschlag gleich zu Beginn vorweggenommen wird, um sodann einige Zeit zurückzuspringen: Zu der Hochzeit von Justine. Die eigene Hochzeit soll bekanntlich einer der schönsten und erinnerungswürdigsten Tage im Leben sein. Justine empfindet anders. Nicht etwa, weil sie ihren Mann nicht liebt, sondern weil sie hoffnungslos melancholisch ist. Sie verkriecht sich fortwährend und erscheint nicht pünktlich zu den hochzeitlichen Aktivitäten. Gemessen an den gesellschaftlichen Gepflogenheiten verhält sie sich unvernünftig. Ihrem ach so vernünftigen Umfeld fällt es schwer, das nachzuvollziehen. Nachdem Justine ihrer Schwester (Claire) das drückend-graue Gefühl beschreibt, das auf ihr lastet, suggeriert diese, sie solle sich bloß nichts anmerken lassen. Ihr Schwager (John) legt ihr nahe, doch bitte ein breites Lächeln an den Tag zu legen, immerhin bezahle er für die Hochzeit, die in seiner gigantischen Villa inmitten von sterilem Reichtum unter sterilen Reichen stattfindet. Ihr Chef will den Werbeslogan für seine neueste Kampagne aus ihr herauspressen, während sich ihr frisch gebackener Ehemann mit ihr in ein Zimmer zurückziehen möchte – und das, obwohl Justines tiefe Traurigkeit für alle sichtbar ist. Sie widersetzt sich der sozialen, ökonomischen und männlichen Rationalität und steht am Ende des Tages ohne Freunde, Job und Ehemann dar.
Was zuvorderst eine tiefgründige Reflexion über die Depression ist, lässt sich gerade über eine Kontrastierung mit Don’t Look up auch umfassender lesen. Denn die zweite Hälfte des Films spielt nach der Hochzeit und dreht sich primär um Claire und John. Der heranrauschende Planet, der sich bereits in der Hochzeitsnacht ankündigte, ist mittlerweile deutlich näher an die Erde gerückt. John macht sich keine Sorgen. Schließlich vertraut er auf die Wissenschaft und die Wissenschaft hat berechnet, dass der Planet ein Flyby ist, also in einem spektakulären Bogen an der Erde vorbeifliegt – genau gegenteilig zu den Kalkulationen in Don’t Look up. John steht damit repräsentativ für den rationalen Bürger im Kapitalismus neoliberaler Ausformung. Er ist ökonomisch äußerst erfolgreich. Auf seinem Golfplatz finden sich ganze 18 Löcher. Er ist hoch individualistisch und managet alles im Alleingang. Sein Anwesen ist weit weg von der Gesellschaft und er verhält sich dennoch gemäß ihren Gepflogenheiten. Seine Psyche scheint makellos und der Anzug sitzt. Er lässt sich nicht von irgendwelchen Verschwörungsmystikern aus dem Internet verführen. Auf seiner Terrasse prangt ein luxuriöses Teleskop. Er ist optimistisch und belächelt die ängstliche Claire. Mitsamt der Ordnung, für die er steht, bildet John das verkehrte Spiegelbild zu Justine.
Justine ist nicht makellos, sondern schwer krank. Sie ist arbeitslos und auf die Hilfe anderer angewiesen, denn die alltäglichsten Geschäfte bereiten ihr Schwierigkeiten. Die Wissenschaft interessiert sie nicht. Sie ist wie gelähmt. Aber sie weiß etwas. Sie weiß, dass der Planet die Erde treffen wird. Woher? Einfach so. Sie ahnt nun mal Dinge. Die Vernunft, die sie darin anwendet, ist anders geartet als der zweckrational-ökonomische und positivistische Verstand von John. Es ist eine Form von Weisheit. Eine intuitive, unmittelbare Einsicht in die allerallgemeinsten Prinzipien, die selbst nicht weiter begründet werden können, aber die Grundlage für alle weiteren Begründungen bilden. So weiß Justine auch, dass es kein weiteres Leben im Universum und damit auch keine Hoffnung auf etwas gibt, das den Sinnhorizont derjenigen mickrigen Existenzmasse übersteigt, die nun vom Untergang bedroht ist. Dennoch bereitet ihr dieser Untergang keine Sorgen. Warum?
»“Das ist die Kraft der Melancholie, die nicht nur eine Trauer über den sich jederzeit ereignenden Verfall, sondern auch eine Sehnsucht nach dem Verfallenen darstellt, bei dem es sich allzu häufig um Verbindungen mit anderen Menschen handelt.”«
Gemeinsamer Verfall
Als Melancholikerin ist Justine mit dem Verfall vertraut. Sie spürt ihn überall. In jedem noch so kleinen, noch so scheinbar-schönen Moment, der in ihren Augen sogleich zu Staub zerfällt, damit er durch ihre Hände rieseln und sie ihm nachtrauern kann. Ihre Sanduhr läuft ständig. Jedes Detail ist wie eine reife Frucht, die sich auf den zweiten Blick als innerlich verfault und verdorben herausstellt. Doch gerade weil ihr der Verfall in jedem noch so geringfügigen Kontext bekannt ist, ängstigt er sie auch nicht im Ganzen. Darin steckt eine Form von Hoffnung. Der neoliberale Optimist verzweifelt, sobald er merkt, dass seine Berechnungen versagt haben. Der Anblick der Katastrophe lässt ihn zum allerschnellsten Exit greifen. John stirbt, den Mund voller Pillen, alleine im Pferdestall. Seine Frau verfällt in Panik. Doch Justine harrt aus. Sie baut ein schützendes Dach über den finalen Moment und schafft es so, ihn ausnahmsweise einmal fest in den Händen zu halten. Und sie baut dieses Dach nicht nur über sich selbst, sondern auch über die anderen oder sie baut es gerade für und wegen der anderen.
Hierin kommen Don’t Look up und Melancholia trotz ihrer Differenzen endlich überein. Denn auch in Ersterem sitzen die Wissenschaftler:innen zum Schluss bei Freund:innen und Familie, um das Ende der Welt gemeinsam zu bewältigen. Das ist die Kraft der Melancholie, die nicht nur eine Trauer über den sich jederzeit ereignenden Verfall, sondern auch eine Sehnsucht nach dem Verfallenen darstellt, bei dem es sich allzu häufig um Verbindungen mit anderen Menschen handelt; Verbindungen zwischen isolierten Individuen, die im Angesicht der Apokalypse wiederbelebt werden können, um kollektives Handeln zu ermöglichen. Wenn man nicht die hoffnungslose Verblödung, sondern die melancholische Vernunft der zerrütteten Massen zum Fluchtpunkt wählt, gelingt eine solche kollektive Wiederbelebung vielleicht sogar bevor der Einschlag trifft. Vielleicht aber auch nicht. Dann kommt das Ende eben doch. Ach, soll es kommen.

David Winterhagen

Kommentar
Tourists go home
A collection of thoughts on overtourism
von Gabriella Ramus
18.04.2023 - Ausgabe 90
Strong white lights coming from a phone case store blind you. A remix of Levitating by Dua Lipa is playing on full blast. Small sound boxes are suspended by fragile wires while also emitting potent, strident noise. Further ahead, a distinct grease smell swallows up your nostrils. A menu in English with big fat pictures of food appears in front of you: if you want hamburgers, they have it, if you want pizza, they have it, if you want tacos, kebap, salad, french fries or sausage, they also have it. A bit further, you see it. A gift shop in all its glory, the infamous oasis for paraphernalia. Kitsch postcards (which will be given to even kitscher relatives), vulgar magnets (which will be given to even more vulgar friends), can openers, plushies, keychains, t-shirts, pens, … Everything that can be printed with the name of a European city, but produced in China. Everything that can send the simple message of “I was in X (insert here name of tourist city) and you weren’t. That is why I brought you this souvenir”.
Tourist cities are more than cities full of gift shops, generic restaurants for foreign picky eaters and flashy stores for cellphone accessories. Logically, they are also full of tourists. Your walk down a tourist city’s street wouldn’t be complete without an American teenager screaming in your ear “That’s cute!” while pointing at a store window; or without spotting a German couple with their matching trekking Jack Wolfskin jackets and Deuter backpacks; or without being blocked by an excursion of chatty Spanish highschoolers. Your experience in a tourist city cannot be authentic if you don’t question the authenticity of everything. Or if you don’t create a game of guessing the nationality of other people, or if you don’t complain about the prices of everything you decide to swipe your credit card for (bonus points if you call it a steal).
I am no tourism hater. I am also not here to convince you, dear reader, to not go to Paris. This is only a small collection of thoughts gathered by my travels in Europe over the last years – since the COVID travel restrictions have been cut out – and drafted while I spend the night alone at the Bologna airport with nothing better to do.
For me, 2023 started in Madrid with a friend of mine that had been doing her Erasmus semester at the Spanish capital. After a failed attempt to hear the twelve bell strikes and eat twelve grapes without gagging at the Plaza Puerta del Sol on New Year’s Eve, we decided to spend a couple of days in Barcelona. This was the city that inspired this article.
»“ Your experience in a tourist city cannot be authentic if you don’t question the authenticity of everything.”«
Even though I had heard marvelous things about the Catalan beach, Gaudi’s artsy architecture and the delicious paella, I couldn’t help but feel a bit disappointed – classic Paris syndrome, I know. It was very hard to grasp at the real Barcelona, not the one catered to tourists. What do people from Barcelona do on Sundays? Where do they go? What do they eat? Besides not hearing any Catalan on the streets, we barely saw people that looked like they lived there. The whole city felt like it only functioned for tourists. Metro instructions, menus and museum signs were in English. To go to the park, you had to pay (10€ to Park Güell), to go to the church, you also had to pay (26€ to Sagrada Familia). You don’t have to pay to dance with the elderly on the beachfront or to chat to the bakers about Putin though. Yet.
It is a weird feeling when you find yourself in a space that was designed to cater to you as a tourist and to provide a standardized experience. Of course, my friend and I decided to do the sightseeing activities, so the blame is partly ours. Still, we only rarely saw any locals, and it’s a shame that they avoid going near the beautiful spots that made their city so popular in the first place.
My experience in Florence in the beginning of March was very similar – this time, however, I was with my mom. The streets were so full of Americans, it felt like we were in Epcot Italy at Disney World (we later found out it was during their spring break). We wondered where the ‘Fiorentinos’ were, and we wondered how they felt about their city being flooded with foreigners. It must not be great to take buses so full, you feel like a canned sardine; or to take double the time to get anywhere in the city center because of all the people in your way; or to struggle to pay for rent in the city you were born in, since Airbnbs marketed the prices up so high. For us, the four days we were in Florence quickly became insupportable, but it was only four days. I can’t imagine how it is to live in the city and have this be your everyday reality. Sadly, it’s the locals that suffer the most from overtourism.
The situation turns even sadder when gigantic transnational companies drown out local businesses to satisfy a wider international audience. For example, when a McDonald’s across the street from a family restaurant swipes all the clients because tourists are more familiar with the brand or don’t even know that the other place exists. The city centers are, after all, filled with H&Ms, Burger Kings, Zaras, KFCs, Dunkin’ Donuts and Subways.
Venice also comes to mind when one speaks of mass tourism. I recently found a picture of my great-grandparents in Venice, where they had their honeymoon, and I thought a lot about how their experience in the 1930s and mine in the 2010s might have been different. Their Venice was Venice. My Venice was an amusement park Venice. Locals told me that they had to move from Venice to Mestre, a neighboring city, because they couldn’t afford rent or living costs anymore. I didn’t see any supermarkets in Venice, I only saw restaurants decorated with white and red checkered tablecloths, grissini wrapped in plastic, fake flowers, and plastered with the words “Great authentic Italian cuisine” in cursive font (yes, in English).
The city halls don’t want to do anything about it since more tourists mean more money and there is not much to do about it either. They can increase the price of tourism fees and use the money for site conservation or limit lodging options, but they can’t prohibit tourists from coming. It’s a double-edged sword without a real solution. Tourism can work well when sustainably balanced, but no one can truly control how many people want to see a place with their own eyes.
I first found it funny to find graffiti that read ‘Tourists go home’ on my way to Park Güell. I later found it depressing. In which phase of global capitalism are we when cities only function for people that don’t actually live there? And how is the maximum that a normal citizen can do about it is to beg tourists to leave through a sad message on the wall?
I don’t blame Parisians for being rude to tourists because I would be mad as well.

Gabriella Ramus

Bericht
Warte, warte nur ein Weilchen …
Zum Energiegeld für Studierende
von Jan Bachmann
18.04.2023 - Ausgabe 90
Energiepauschale beantragen - so geht’s:
1. Bund.ID anlegen auf id.bund.de könnt ihr euch unter der Option „Benutzername und Kennwort“ auch ohne Online-Perso eine Bund.ID erstellen
2. Antrag stellen auf Einmalzahlung200.de
3. Berechtigungscode und PIN findet ihr unter Studienservice.uni-bonn.de
So manche:r von euch hat sich wohl schon mehr als einmal mit sorgenvollem Blick auf die eigenen Kontoauszüge über die endlos scheinende Wartezeit auf das Energiegeld für Studierende geärgert. Kritisiert hat die Wartezeit auch der AStA der Uni Bonn, ebenso der fzs, der freie Zusammenschluss von Studierendenschaften, geändert hat dies wenig. Oder vielleicht doch, denn wer weiß, vielleicht hätte es sonst noch ein paar Monate länger gedauert, bis das Energiegeld endlich ausgezahlt wird. Wie dem auch sei, seit dem 15. März kann nun das Geld beantragt werden, die Auszahlung erfolgt meist schon nach wenigen Tagen.
Beschlossen vor einem halben Jahr
Durch das Kabinett beschlossen wurde die Einmalzahlung vor einem halben Jahr, wer sich seitdem nach dem Zeitpunkt der Auszahlung erkundigte, der bekam von Frau Stark-Watzingers Bildungsministerium unterschiedliche Auskünfte, die Auszahlung sollte mal „noch im Jahr 2022“ dann „zu Beginn des Jahres 2023“ erfolgen — stets aber arbeitete man mit „Hochdruck“ an der Umsetzung. Schließlich wurde es Frühjahr, bis Studierende endlich ihre Einmalzahlung beantragen konnten. Genau rechtzeitig zu den Heizkostenabrechnungen für den vergangenen Winter hieß es erklärend seitens des Ministeriums. Eine freilich recht fadenscheinige Entschuldigung: Die Heizkostenabrechnungen kommen schließlich erst in einigen Monaten, mit den hohen Abschlägen haben die Studierenden allerdings schon seit Monaten zu kämpfen. Auch bleibt offen, warum die Auszahlung des Energiegeldes für Studierende im Frühjahr — laut Ministerium — genau zum richtigen Zeitpunkt erfolge, es hingegen bei der Auszahlung des Energiegeldes für die Arbeitnehmer:innen im Herbst so schnell gehen musste, dass bewusst auf eine zielgenaue Auszahlung an jene, die das Geld tatsächlich brauchen, verzichtete wurde. Hier sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass die Universität Bonn sich bewusst dafür entschieden hatte, das Energiegeld zwar eigentlich an alle Beschäftigten, nicht jedoch an die studentischen auszuzahlen. Studentische Hilfskräfte erhalten das Geld erst, wenn sie eine Steuererklärung machen.
Beantragung nicht immer ganz so einfach
Die Beantragung des Geldes dauert — rechnet man die notwendigen Vorbereitungen mit ein — auch ein wenig länger als ursprünglich angekündigt, inzwischen kommt es allerdings kaum noch zu Wartezeiten auf der Homepage. Da die Universität Bonn — wie auch die anderen Universitäten und Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen — auch eine PIN an ihre Studierenden ausgegeben hat, reicht für die Beantragung des Energiegeldes ein BundID-Konto, das lediglich mit Benutzernamen und Passwort erstellt wurde. Anderenorts ist hingegen ein BundID-Konto notwendig, das mit einem Online-Personalausweis erstellt wurde. Da dieser wiederum standardmäßig erst ab 2017 ausgegeben wurde, müssen viele Studierende, die vor dem Jahr 2001 geboren wurden, erst einen neuen Personalausweis beantragen, verbunden mit entsprechendem Aufwand.
»“Eine dauerhafte Lösung für die prekären finanziellen Verhältnisse, in denen viele Studierende leben müssen, ist das Energiegeld sicher nicht.”«
Studierende stark betroffen
Dass alle Studierenden die Einmalzahlung erhalten können, ist sicherlich sinnvoll. Gewiss gibt es auch Studierende, die nicht unbedingt auf die Zahlung angewiesen sind, doch dürfte ihr Anteil weitaus geringer sein als der Anteil der Arbeitnehmer:innen, die ihr Energiegeld nicht wirklich nötig hatten. Gerade Studierende, die ja in ihrer Mehrheit ein eher geringes Einkommen haben und daher auch einen recht hohen Anteil ihres Einkommens für Energie, aber auch für Lebensmittel ausgeben — gerade in diesen Bereichen gab es ja die größten Preissteigerungen — leiden besonders unter der Inflation. Bedenken sollte man auch, dass andere Hilfsmaßnahmen, wie etwa die Gas- oder Strompreisbremse, für viele Studierende keine wirkliche Entlastung bringen. Beide Instrumente deckeln die Kosten für 80% der Jahresverbrauchsprognose, die sich im Wesentlichen aus dem Vorjahresverbrauch ergibt, auf einen günstigen Preis. Für Energie, die darüber hinaus verbraucht wird, muss der aktuelle, hohe Preis bezahlt werden. Da viele Studierende — sei es aus ökologischem Bewusstsein, aus Kostengründen oder schlicht, weil sie gar keine Möglichkeiten haben, unnütz Energie zu verbrauchen — bereits in der Vergangenheit wenig Energie verbraucht haben, wird es ihnen oft nicht möglich sein, ihren aktuellen Verbrauch auf 80% des Vorjahresniveaus zu senken. Darüber hinaus sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass Studierende im Vergleich zur Gesamtbevölkerung wesentlich häufiger umziehen, sie also häufiger Neukund:innen bei ihren Energieversorgern sind und entsprechend teurere Tarife haben.
Was wichtiger ist
Eine dauerhafte Lösung für die prekären finanziellen Verhältnisse, in denen viele Studierende leben müssen, ist das Energiegeld sicher nicht. Auch das BAföG schafft hier — trotz jüngster Reform — nur bedingt Abhilfe. Natürlich auch keine dauerhafte Hilfe wäre es gewesen, wenn Studierende — wie auch Arbeiternehmer:innen oder Rentner:innen — 300 Euro Energiegeld bekommen hätten, obwohl sicherlich die meisten Studierenden die 100 Euro mehr sicher gut hätten brauchen können. Dass es dann nur 200 Euro wurden wirkt, gerade auch noch in Verbindung mit der verschleppten Auszahlung, geradezu wie ein Symbol für eine Politik, die die Interessen der jungen Generation nicht wirklich ernst nimmt. Wenn man auch den Studierenden 300 Euro ausgezahlt hätte, wären dadurch übrigens Mehrkosten in Höhe von 350 Millionen Euro entstanden (vorausgesetzt, dass auch alle 3,5 Millionen berechtigten Studierenden das Geld beantragen). Der Tankrabatt, mit dem der Staat im letzten Jahr für drei Monate die Spritpreise abgesenkt hatte, hat 3,13 Milliarden Euro gekostet.
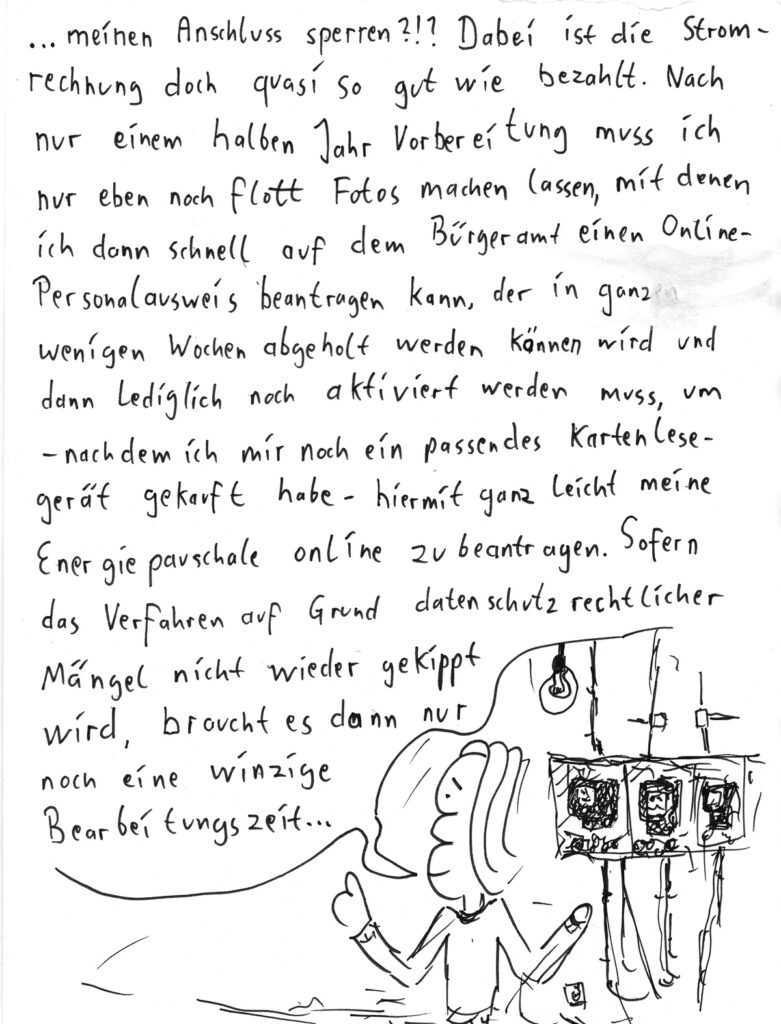

Jan Bachmann

Kolumne
Über den Wolken
Zwischen Blasphemie und Wanderlust und am Ende etwas Frust
von Helene Fuchshuber
18.04.2023 - Ausgabe 90
Es sind Ferien. Und weil Ferien sind, mach ich Urlaub fürs Gehirn und lass meine Seele baumeln. In Südamerika. Ich hab meinen Job nicht verlängert, hab eine Hausarbeit mit Ach und Krach mehr schlecht als recht einen Tag vor Abflug abgegeben und dann saß ich im Flieger. Drei Tage später dann doch, wegen Streik, aber dann hob ich ab. Ein bisschen fühlte sich das an wie Blasphemie oder mich selbst verraten und meine Prinzipien, in Ermangelung von einem Gott. Aus meiner Perspektive.
Von oben betrachtet hab ich wenig gesehen und die meiste Zeit geschlafen oder Filme gesehen, wobei eigentlich nur einen, aber jedenfalls nicht aus dem Fenster auf die Welt, weil ich auf einem Sitz in der Mitte des Flugzeugs saß. Und so auch über den Wolken keinen Gott gefunden oder so was in der Art, sondern nur einen Jungen neben mir, der mich krass an meinen Bruder erinnerte. Er schlief mit dem Kopf auf meiner Schulter und ich habe mich sicherheitshalber nicht mehr bewegt. Endlich angekommen wurde ich mir meiner mangelnden Spanischkenntnisse schnell schmerzlich bewusst und außerdem dem schleichenden Verfall mit Mitte 20. Meine Beine und Füße waren dick geschwollen und ich fragte mich, wie das erst im Alter wird.
Wenig später baumelten meine Beine in einem Pool und meine Seele kam eine Woche später auf einer 18-stündigen Busfahrt auch an. Es ist verrückt, wie sehr ich das gemerkt habe.
Die erste Woche war ich nicht hier und nicht da. Ich saß irgendwie auf dem Balkon eines Airbnb und hatte das Gefühl, schon ewig nicht mehr in Bonn zu sein, obwohl ich am Tag vorher noch in Köln war. Gleichzeitig wusste ich überhaupt nicht wohin mit mir und wo ich war und wer und was ich da wo ich war, wo immer das auch war überhaupt wollte.
Eine Woche später auf dem Weg in den Süden Argentiniens ging ein Fenster in meinem Kopf auf und vor dem Busfenster türmten sich Wolken, bei deren Anblick ich wusste, warum Menschen anfingen, den Himmel zu malen und darin einen Gott.
Die einzelnen Fragen des Wer und Wo und Warum kann ich zwar immer noch nicht beantworten, aber während mir der Wind ganz oben auf einer Bergspitze in den Anden um die Ohren brauste, war mir kaum was egaler. Auf dem Weg nach oben verfluchte ich meine Entscheidung, nur ein paar Sneaker mitzunehmen und dachte kurz, das wird nix, nein nein, ich bleib hier mitten im Berg. Aber oben angekommen nahm ich mir fest vor, zukünftig eher mit dem Fahrrad nach Köln zu fahren als mit der Bahn (wer‘s glaubt wird selig). Überhaupt weniger faul zu sein. Mehr andere Dinge zu tun. Also andere, als die, die ich normalerweise mache. Mehr ja zu sagen und weniger vielleicht eines Tages.
»“Ein bisschen fühlte sich das an wie Blasphemie oder mich selbst verraten und meine Prinzipien, in Ermangelung von einem Gott. Aus meiner Perspektive.”«
BeReal zeigt zwar immer nur mich in wechselnden Hostels und meinen Rucksack in verschiedenen Packstadien, aber in Echt habe ich in den letzten Tagen mehr gesehen als in ganz viel Zeit davor. Wir haben irgendwo in den Anden bei der Grenzkontrolle gefrühstückt – wie ist eigentlich das Essen? Fragte meine Mama. Naja, Joni hat Bauchprobleme, so richtig mit Antibiotikum, also Schonkost und Kekse, Brot und Bananen, was man gut mitnehmen kann halt. Sagte ich. Aah, das klingt nach ‘ner interessanten Mischdiät, schrieb sie – Brot mit Frischkäse und dazu drei Bananen, da man über die Grenze keine Früchte mitnehmen durfte. Stadt um Stadt leert sich danach der Bus, alle Aktivtouris steigen aus, um die Berge der Welt zu erklimmen. Wir fahren ans Meer.
Und da weiß ich dann wieder, warum ich mir das vorletzte Mal als ich einen Ozean gesehen habe, damals Atlantik, heute Pazifik, mehrmeer stechen ließ. Erst wenn du’s unter der Haut hast, warst du da, jaja. Naja. Joni sagt, der Pazifik macht ihn ganz bedächtig. Grounded ihn, denn daneben sind wir so winzig. Und wieder sehe ich in der Gischt, die gelb um meine Füße gespült wird, die ganz taub von der Kälte sind, warum Menschen in der Antike Göttinnen daraus emporsteigen ließen.
Ich bin übrigens nicht spontan gläubig geworden in den letzten Tagen.
Aber mein Kopf ist aufgegangen und ich habe mal wieder den Beweis dafür in der Tasche, dass Reisen eben wirklich Blickwinkel verändern kann und Tellerränder erweitern. Ich glaube nicht, dass das zwangsläufig passiert – die zwei Jungs bei uns im Hostelzimmer, die abends ab 8 mit Handy im Bett hängen, wirken nicht so zufrieden, so weit weg von zu Hause (wo auch immer ihres ist). Für mich kann Wegfahren aber genau das tun. Mich einmal resetten und gleichzeitig zu mir zurückbringen, während ich trotzdem ganz und ganz woanders bin.
Ich weiß, dass das ein Ausnahmezustand ist und ich bin unfassbar dankbar, dass ich das gerade erleben kann. Ich bleib auch doch weiter bei meinen Prinzipien. Bleibe Vegetarierin Richtung vegan. Ich werde weiterhin Vorträge darüber halten, wie scheiße ich Fliegen finde und dass so viele Menschen so viele Wege mit dem Auto erledigen. Ich bleibe vermutlich auch dabei, Lisas, die nach dem Abi nach Australien reisen, ein bisschen zu verurteilen. Aber insgeheim hab ich auch eine Lisa in meinem Herzen. Und würde am liebsten hierbleiben. Naja. Halbzeit ist rum und ich komm definitiv zurück. Aber erstmal hat mein Hirn noch Urlaub. Und so liege ich mit Sonnenbrand in einem Doppelstockbett und hänge genauso wie die oben erwähnten Jungs am Handy, weil ich nicht schlafen kann. Ist aber egal, morgen mal wieder lange Busfahrt.
»“Auf dem Weg nach oben verfluchte ich meine Entscheidung, nur ein paar Sneaker mitzunehmen und dachte kurz, das wird nix, nein nein, ich bleib hier mitten im Berg.”«
//
Zurück in Bonn kracht ein bisschen Realität über mir zusammen. Die Sonne scheint nur so ab und zu hinter diesigen und gar nicht göttlichen Wolken hervor und ich sitze wieder in drei Pullis an meinem Schreibtisch an der nächsten Hausarbeit. Was ist dieses Ding mit dem Urlaub. Frage ich mich. Ich bin gar nicht so sehr auf dem Trip, ständig von Trip zu Trip von Land zu Land zu springen, nie irgendwo anzukommen oder Alltag zuzulassen. Und trotzdem… Kenne ich das nicht nur von mir, sondern vielen Menschen, dass Urlaubszeit krass verklärt und insbesondere hinterher in rosarotes Licht getaucht auf goldenen Podesten erinnert wird. Und so bleibe ich in der grauen Realität dabei, mir mein Urlaubsgefühl bewahren zu wollen. Wie schon vor ein paar Wochen fast gedacht werde ich wohl kaum mit dem Fahrrad nach Köln fahren: Mein Rad ist zu schlecht dafür oder ich fahre zu schlecht Fahrrad oder das Wetter ist nicht schön genug, jedenfalls dauert es mir zu lang. Aber ich halt mich einfach innerlich an dem Stück rosarote Erinnerung fest. An dem Gefühl, weniger faul zu sein und häufiger ja zu sagen. Auch wenn das vielleicht nicht immer der vernünftigste Weg ist und nicht immer umsetzbar. Aber im Grunde ist das ja auch keine konkrete Handlungsanweisung: Fühl dich immer, wie im Urlaub! Sondern mehr eine Frage des Mindsets: Ich will mich nicht nur im Urlaub frei und wie meine Lieblingsversion von mir selbst fühlen. Ich will mich mit meinen Freund:innen, bei mir zu Hause, bei den Dingen, die ich alltäglich mache und zum Teil auch machen muss, darüber freuen, dass das mein Leben ist, genauso wie ich mich über die Bergspitze in den Anden gefreut habe. Vielleicht etwas viel verlangt, so von mir selbst, aber mit kleinen Dingen funktioniert es. Und seien es die knallblauen Glitzerohrringe, die mich fröhlich machen, oder der Sonnenstrahl, der es zu mir auf den Balkon schafft.
//
Noch ein paar Tage später kracht eine andere Realität über mir zusammen. Nicht nur über mir, sondern über dem FW.
Es gibt bald keinen FW mehr.
Ab jetzt. Genauer gesagt.
Nicht weil wir nicht mehr wollen, sondern weil wir apparently nicht mehr gewollt werden und außerdem zu teuer sind. So eine Zeitung von und für Studierende ist ja an sich auch egal. Oder. Braucht ja eh niemand. Ne. Naja jedenfalls ist das Grau etwas dunkler als der Himmel vor ein paar Tagen und sehr viel absoluter. Eher keine Sonnenstrahlen passen da durch, unser Referat wurde gestrichen. Fertig aus.
In Zukunft gibt es vielleicht hoffentlich eine neue Variante von uns. Wirklich unabhängig hoffentlich, vielleicht, eines Tages. Und bis dahin vielleicht bei uns oder bei euch, in Zimmerecken oder Dachstübchen, ein Podest, in rosarotes Licht getaucht, auf dem sich die FWs der letzten Jahre stapeln.

